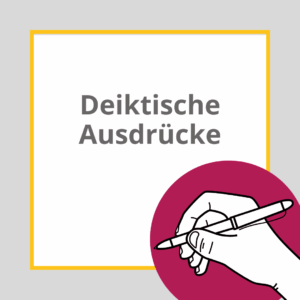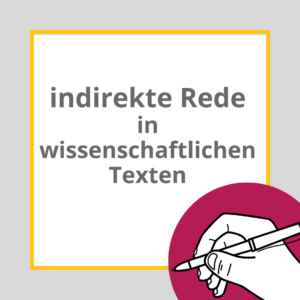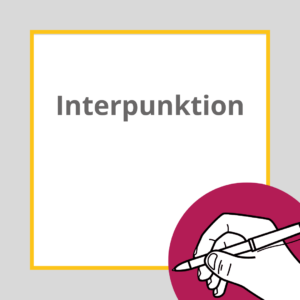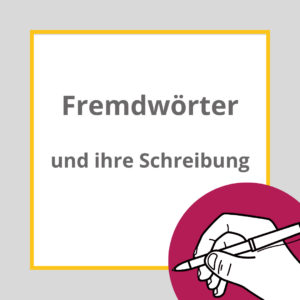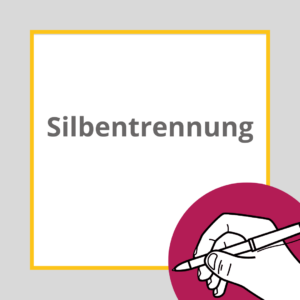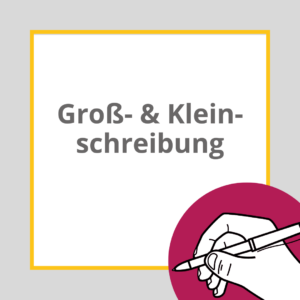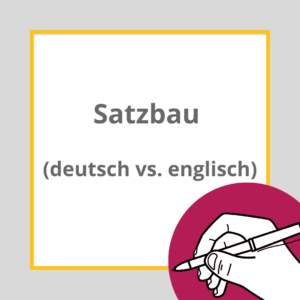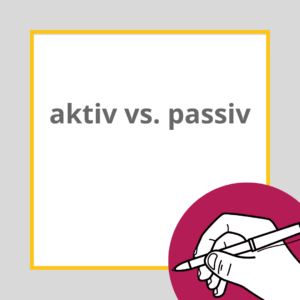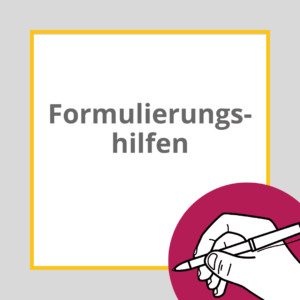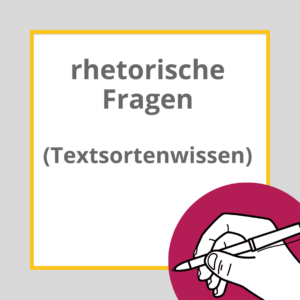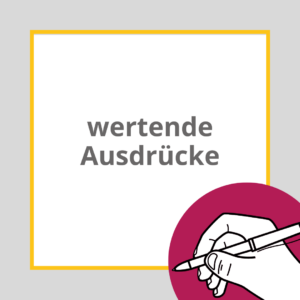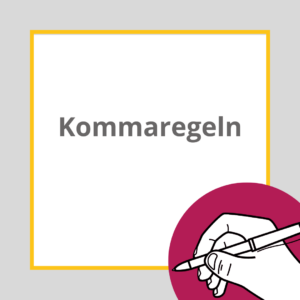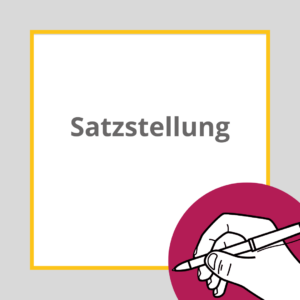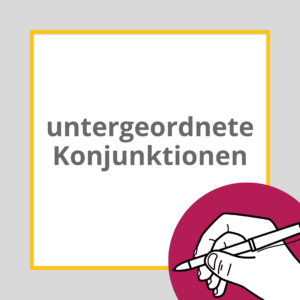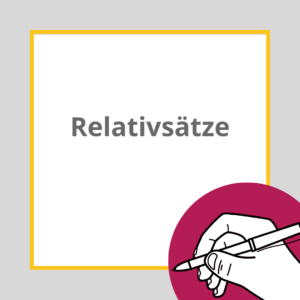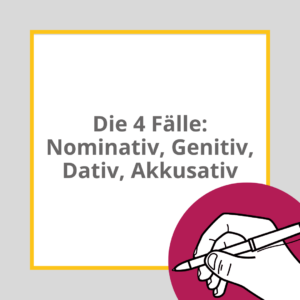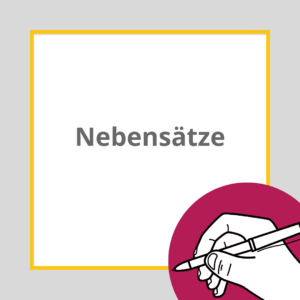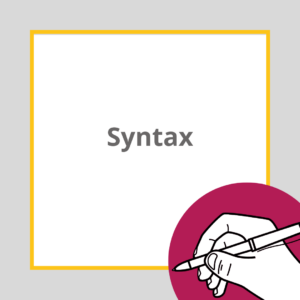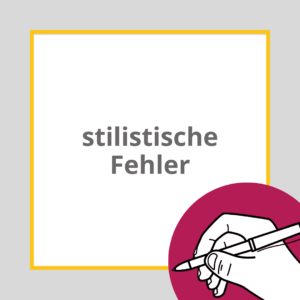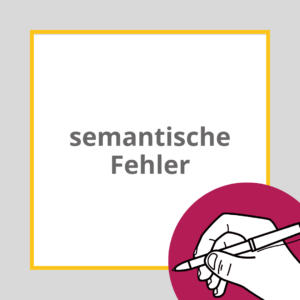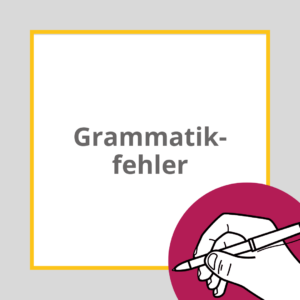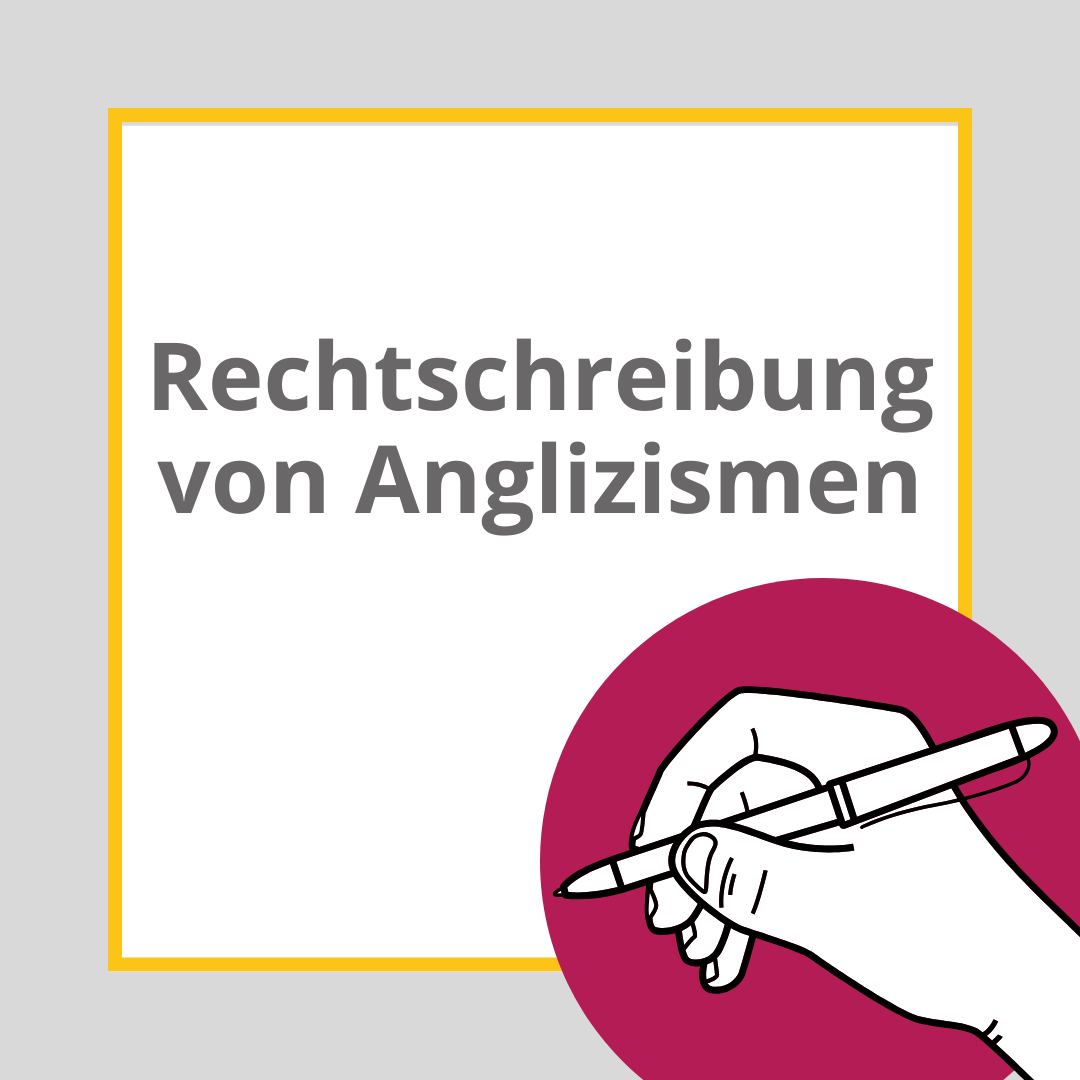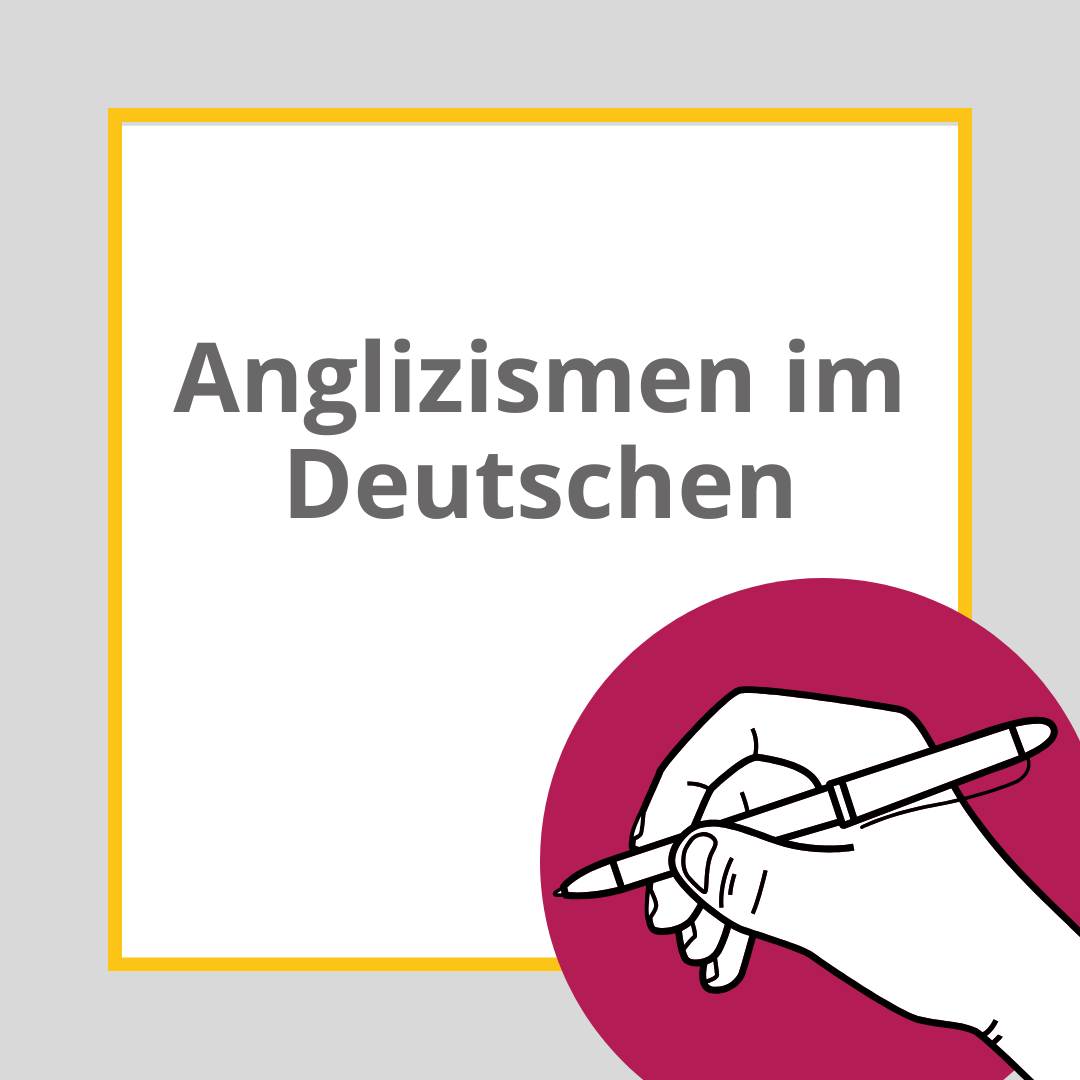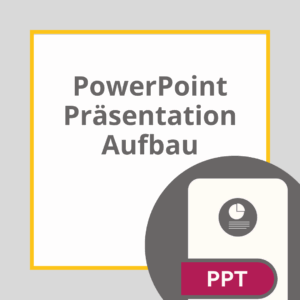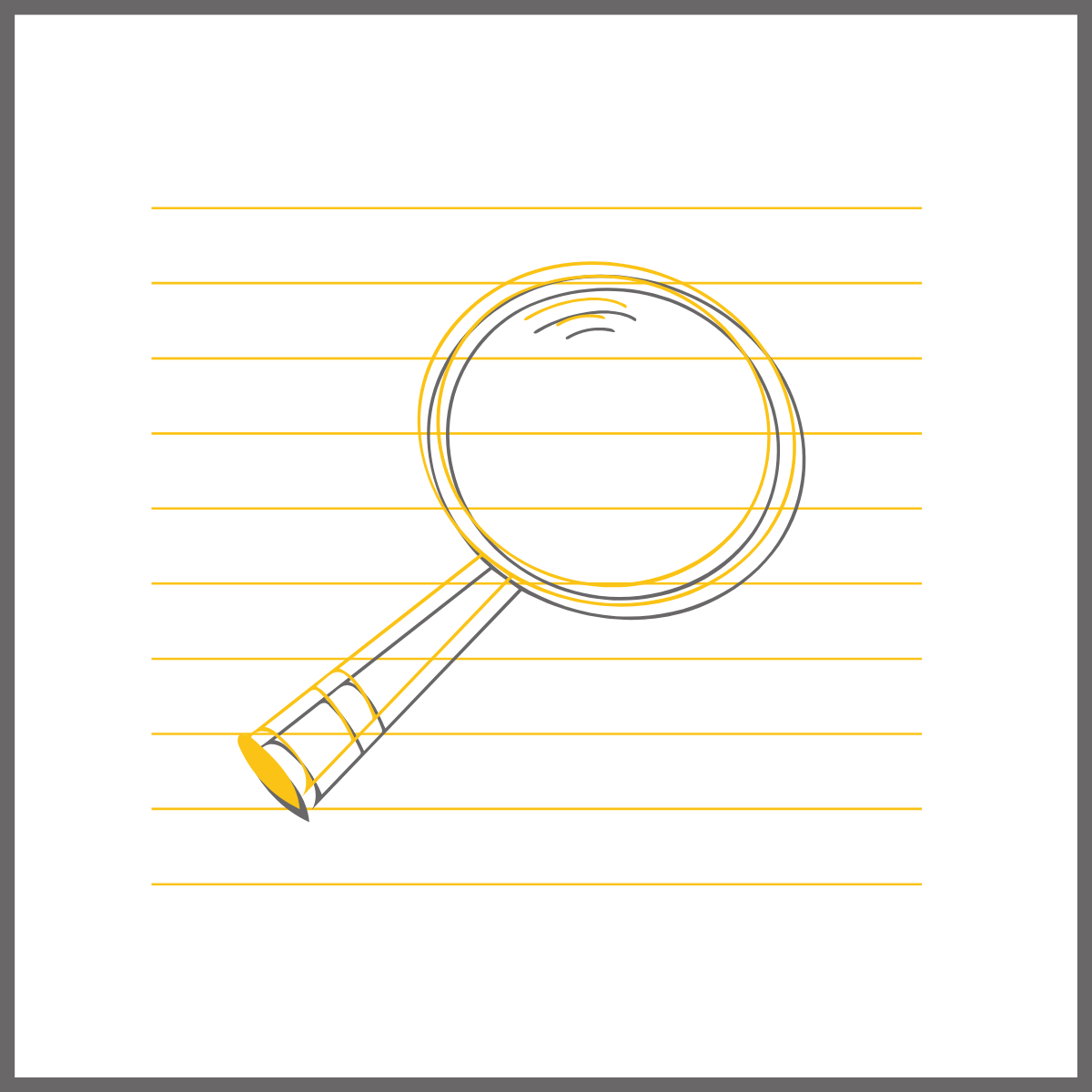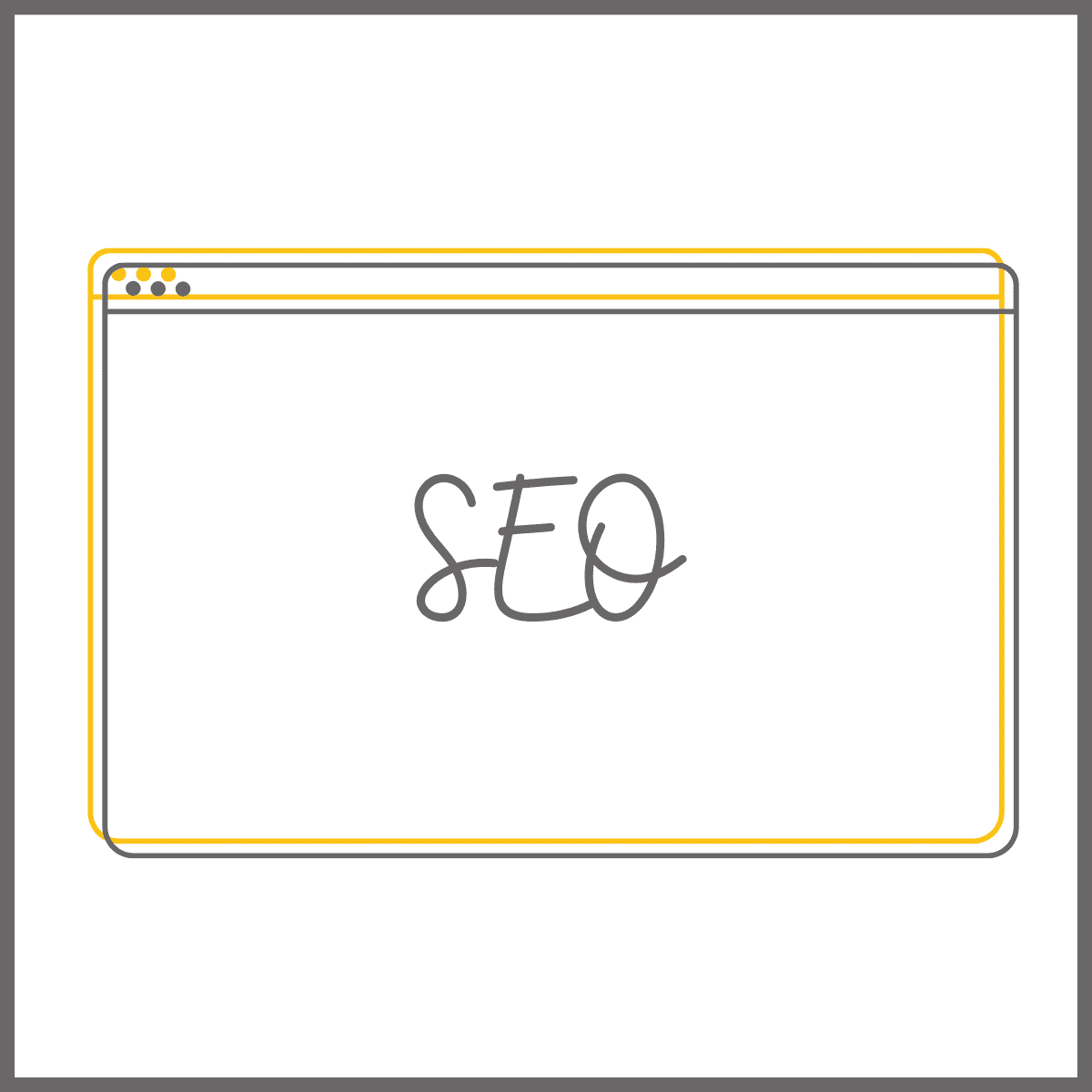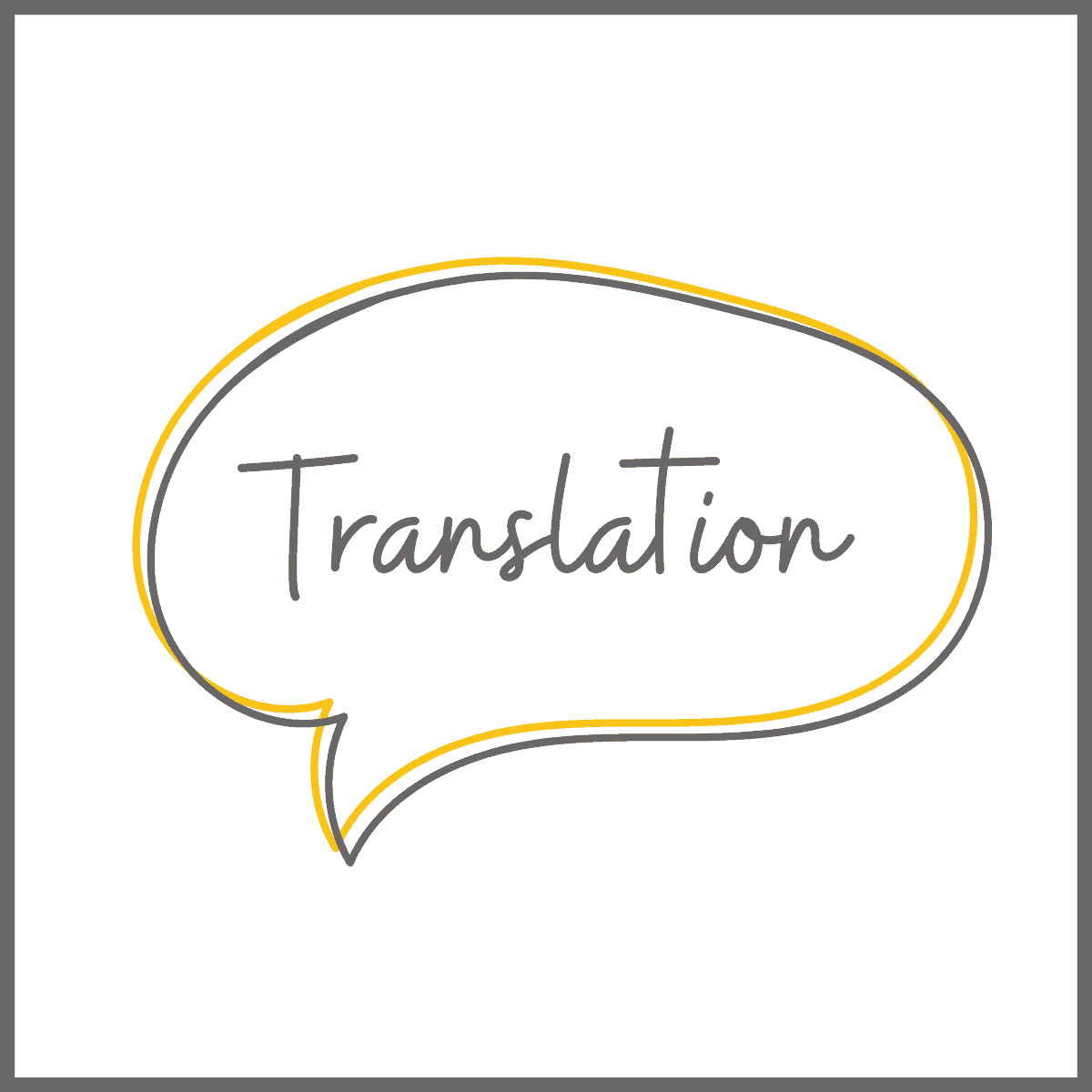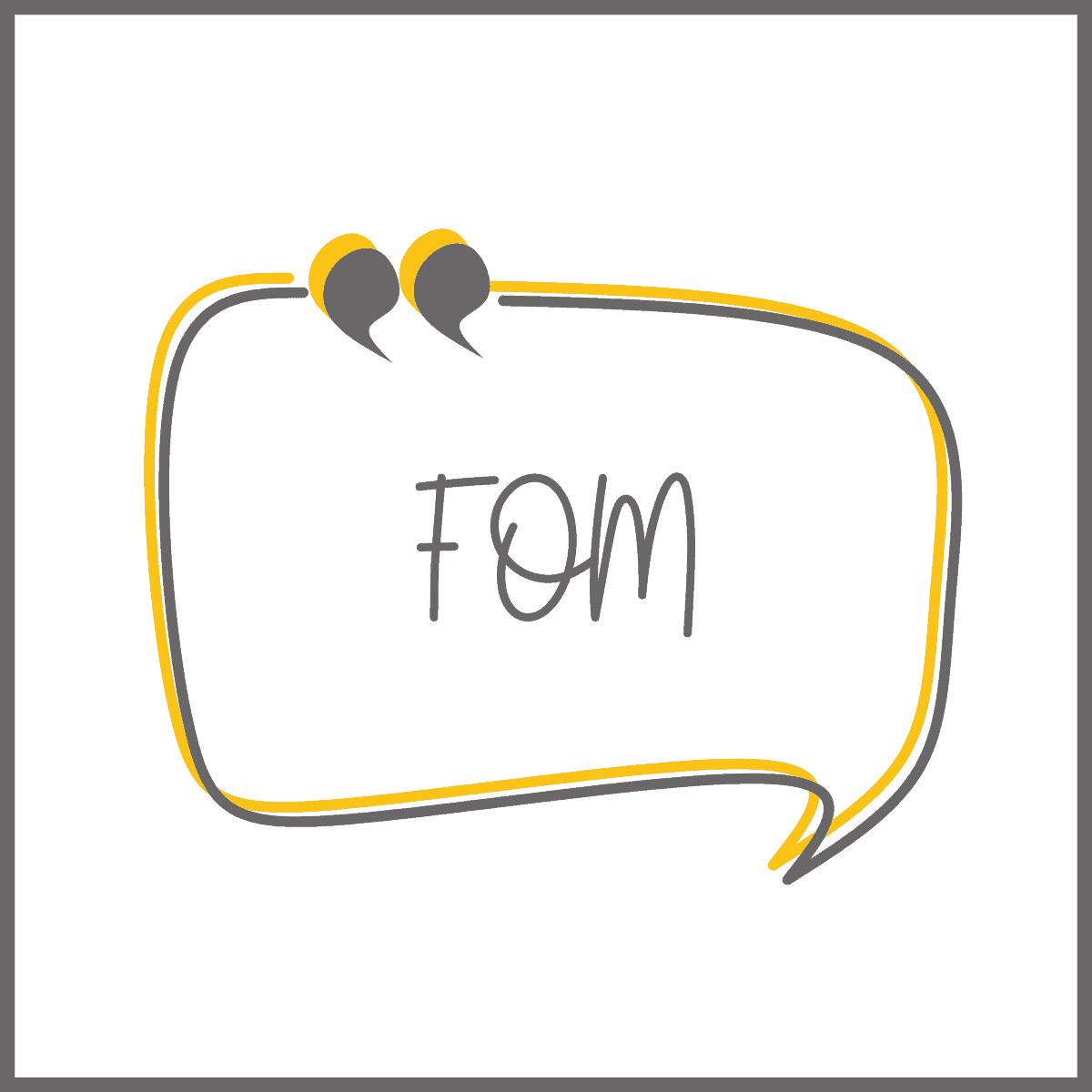Wissenschaftlich Schreiben: Übersicht
Rechtschreibung und Grammatik zeigst du mit deinem Text nicht nur Professionalität und Glaubwürdigkeit in beruflichen oder schulischen Situationen, sondern vermeidest auch Missverständnisse. So überzeugst du unabhängig von Region, Dialekt oder Fachbereich mit einer klarer Ausdrucksweise und einem angenehm lesbaren Text.
Grammatik – was ist das eigentlich?
Teilbereiche der Grammatik
Die Grammatik lässt sich in mehrere Teilbereiche untergliedern, mit der sie mehr oder weniger in wechselseitiger Abhängigkeit steht.
Insbesondere die Morphologie und Syntax sind unbestrittene Teilbereiche der Grammatik:
Bereich | Beschreibung |
– Bezieht sich auf die Struktur und Bildung von Wörtern. | |
– Untersucht, wie Wörter durch Präfixe, Suffixe, Wurzeln und Flexionen (z. B. Konjugation von Verben, Deklination von Nomen) verändert werden. | |
Syntax | – Befasst sich mit der Struktur von Sätzen. |
– Analysiert, wie Wörter und Phrasen zu grammatikalisch korrekten Sätzen kombiniert werden (z. B. Wortstellung, Subjekt-Prädikat-Objekt). |
Auch die Semantik und die Orthografie sind stark mit der Grammatik verbunden, weisen jedoch auch weitere Forschungsfelder außerhalb dieser auf.
Bereich | Beschreibung |
| |
Semantik | – Beschäftigt sich mit der Bedeutung von Wörtern und Sätzen. | ||
– Untersucht, wie grammatikalische Strukturen zur Bedeutung beitragen. | |||
Orthographie | – Die Regeln zur Rechtschreibung einer Sprache, einschließlich Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Worttrennung. | Verbindung mit der Grammatik | |
Mit der Grammatik in Abhängigkeit stehen ebenso die Phonologie (oft auch mit Phonetik zusammengefasst) sowie die Pragmatik:
Bereich | Beschreibung |
|
|
Phonologie und Phonetik | – Phonologie: Behandelt die Lautstrukturen einer Sprache. | Verbindung mit der Grammatik | |
– Phonetik: Untersucht die Aussprache der Laute. | |||
Pragmatik | – Analysiert, wie Sprache in bestimmten Kontexten verwendet wird, einschließlich Höflichkeitsformen und Idiomen. | Verbindung mit der Grammatik |
Häufige Grammatikfehler beim wissenschaftlichen Schreiben
Verben im Singular oder Plural? Prüfe, ob das Subjekt deines Satzes Singular oder Plural ist und mit der Verbform übereinstimmt. Listest du mehrere Aspekte auf, so steht das Verb im Plural. Insbesondere die Wiedergabe von wissenschaftliche Inhalten der Autoren XY et al. stellt hier einen häufigen Fehler dar: „et al.“ zeigt an, dass es sich um mehrere Autoren als den im Text erwähnten handelt, der folgende Inhalt muss also im Plural stehen.
- Vollständiger Satz? Ein Hauptsatz besteht mindestens aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Sind diese in all deinen Sätzen vorhanden? Häufige Fehler sind unvollständige Sätze oder alleinstehende Nebensätze.
Beliebt für Letzteres ist die Konjunktion „denn“ am Satzanfang: „Denn die Anzahl der Probanden ist sehr gering“. Versuche dies zu vermeiden.
- Stimmt der Bezug? Nicht nur Deiktika, sondern generell Wortarten, die Bezug auf zuvor Erwähntes nehmen, sind oftmals mehrdeutig oder unverständlich. Prüfe also, ob immer klar ist, auf welche Information du dich beziehst.
Fallen stellen hier vor allem die Wörter „Hierfür“ und „dafür“ dar. Auch bei Konjunktionen wie „deshalb“ und „trotzdem“ solltest du die Nachvollziehbarkeit des Bezugs prüfen.
Rechtschreibung – Was gehört dazu?
Unter ‚Rechtschreibung‘ lässt sich die Gesamtheit der verbindlichen Regeln, die festlegen, wie Wörter, Sätze und Texte korrekt geschrieben werden, zusammenfassen. Sie bildet die Grundlage für eine einheitliche schriftliche Kommunikation und bildet damit einen wichtigen Teil der Sprachkompetenz. Als solche ist sie auch ausschlaggebend für die Wahrung kultureller sprachlicher Werte sowie die Weiterentwicklung von Sprache.
Aspekte der Rechtschreibung
In ihrer Vielfalt umfasst die Rechtschreibung eine Bandbreite an Aspekten, die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind:
Bestandteile der Rechtschreibung | Beschreibung |
Regeln zur Unterscheidung von Substantiven, Eigennamen, Anredeformen und Satzanfängen | |
Festlegung, wann Wörter zusammen oder getrennt geschrieben werden, z. B. „kennenlernen“ vs. „kennen lernen“. | |
Zeichensetzung | Richtige Verwendung von Satzzeichen, etwa Kommas, Punkten oder Fragezeichen, um den Satzbau zu strukturieren und Bedeutungen zu klären. |
Orthografische Schreibweise | Korrekte Buchstabenfolge von Wörtern, die den Laut-Buchstaben-Zuordnungen und speziellen Rechtschreibregeln folgt. |
Regeln zur Trennung von Wörtern am Zeilenende, um Lesbarkeit und ästhetischen Fluss zu gewährleisten. | |
Anpassung oder Beibehaltung der Schreibweise von Wörtern aus anderen Sprachen, z. B. „Café“ oder „Portemonnaie“. |
Tipps für eine gute Rechtschreibung in deinen Texten
Um die Rechtschreibung in deinen Texten zu garantieren, kannst du verschiedene Vorgehensweisen und Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Am erfolgreichsten bist du jedoch, wenn du dich an unsere drei Schritte hältst:
Lies deinen Text langsam und sorgfältig durch, idealerweise laut oder in kleinen Abschnitten, um Fehler besser zu erkennen. Achte dabei besonders auf deine typischen Schwächen wie Kommasetzung oder Groß- und Kleinschreibung.
Nutze für das wissenschaftliche Schreiben integrierte Rechtschreibprüfungen in deinen Schreibprogramm. In Word zum Beispiel kannst du dir rot unterschlängeln lassen, was falsch geschrieben ist. Prüfe dabei aber immer, ob die Lösung von Word auch das Wort ist, was du meinst. Solltest du dir unsicher sein, ist der duden.online die beste Anlaufstelle, um die korrekte und präferierte Schreibweise nachzuschlagen.
Alle guten Dinge sind drei: Höchstwahrscheinlich siehst du irgendwann den Wald vor lauter Bäumen oder eben den Text vor lauter Buchstaben nicht mehr. Das ist völlig normal! Daher wird jedem Autor geraten, sich neutrale Hilfe von außen zu holen. Lasse dir beim wissenschaftlichen Schreiben helfen und deinem Lektor deine gesamte Arbeit zukommen. Ohne dein Hintergrundwissen kann der Lektor sich mit deinem Text auseinandersetzen und nicht nur deine Fehler korrigieren, sondern dir auch Rückmeldung darüber geben, was in deinem Text missverständlich oder unklar kommuniziert ist.
Einheitlicher Schreibstil – Warum ist das wichtig?
Um einen Text seriös, verständlich und zielführend zu gestalten, ist neben der Rechtschreibung und der Grammatik auch ein einheitlicher Schreibstil zu beachten. Dieser rundet das Bild von einem gut durchdachten und bewusst verfassten Text ab.
Was ist unter „Schreibstil“ zu verstehen?
Der Schreibstil beschreibt die Art und Weise, wie ein Text formuliert und präsentiert wird. Er umfasst verschiedene sprachliche und stilistische Merkmale, die darüber entscheiden, wie ein Text wahrgenommen wird und welche Wirkung er auf den Leser hat. Dazu gehören die Wahl der Wörter, die Satzstrukturen, die verwendete Tonalität sowie die stilistischen Elemente. Ob ein Text beispielsweise sachlich, emotional, humorvoll oder kritisch wirkt, hängt vom Schreibstil ab. Auch die Struktur und Lesbarkeit eines Textes, etwa durch klare Absätze, logische Gedankengänge oder die Einbindung visueller Elemente wie Überschriften oder Listen, ist Teil des Schreibstils.
Ein Schreibstil kann von verschiedenen Faktoren geprägt sein, etwa der Zielgruppe, der Textsorte oder der Absicht des Autors. In einem wissenschaftlichen Text dominiert in der Regel ein formeller und sachlicher Stil, während in einem Blogbeitrag oder einem literarischen Werk oft ein freierer oder kreativerer Stil gewählt wird. Der Schreibstil gibt dem Text also seine individuelle Stimme und bestimmt maßgeblich, wie er vom Leser aufgenommen wird.
Warum ist ein einheitlicher Schreibstil wichtig?
Ein einheitlicher Schreibstil ist von großer Bedeutung, da er maßgeblich zur Klarheit, Professionalität und Verständlichkeit eines Textes beiträgt. Unterschiedliche Aspekte machen dies deutlich:
Ein Text mit uneinheitlichem Schreibstil wirkt schnell unprofessionell und oberflächlich. Wenn beispielsweise in einem Dokument formelle und umgangssprachliche Ausdrucksweise wechselt, entsteht der Eindruck von Nachlässigkeit. Besonders in der Geschäftskommunikation, im wissenschaftlichen Bereich oder in offiziellen Dokumenten ist Konsistenz entscheidend, um einen kompetenten Eindruck zu hinterlassen. Einheitlichkeit signalisiert, dass der Text sorgfältig erstellt wurde und dass die Inhalte durchdacht sind.
Insbesondere in der Unternehmenskommunikation trägt ein konsistenter Schreibstil wesentlich zum Aufbau einer klaren Markenidentität bei. Kunden und Leser verbinden den Schreibstil mit der Marke oder Organisation und wissen, was sie erwartet. Ein einheitlicher Stil hilft dabei, Vertrauen und eine klare Wiedererkennbarkeit zu schaffen. Ein Unternehmen, das beispielsweise durchgehend einen freundlichen und zugänglichen Stil verwendet, bleibt dem Leser als authentisch und nahbar in Erinnerung.
Eine einheitliche Sprache und Struktur helfen den Lesern, den Text leichter zu verstehen. Wenn der Schreibstil innerhalb eines Dokuments oder einer Kommunikationsreihe wechselt, kann dies verwirrend sein und die Botschaft abschwächen. Ein konsistenter Stil sorgt für Klarheit und führt den Leser klar durch die Inhalte. Besonders in Texten, die komplexe Informationen vermitteln – etwa Anleitungen, wissenschaftliche Publikationen oder Geschäftsberichte – ist ein durchgängiger Stil entscheidend für die Verständlichkeit.
Ein einheitlicher Schreibstil ermöglicht es, die Erwartungen der Zielgruppe zu erfüllen. Jede Zielgruppe hat spezifische Ansprüche und Vorlieben, die es bei der Texterstellung zu berücksichtigen gilt. Ein Text für Fachleute sollte beispielsweise eine präzise und fachsprachliche Ausdrucksweise verwenden, während ein Text für ein breites Publikum allgemein verständlich bleiben sollte. Stilbrüche können dazu führen, dass die Zielgruppe sich nicht angesprochen fühlt oder den Text nicht ernst nimmt.
Ein konsistenter Schreibstil vermittelt Zuverlässigkeit und Professionalität, was sich direkt auf die Glaubwürdigkeit eines Textes auswirkt. Stilbrüche können hingegen dazu führen, dass der Leser den Text als unsicher oder unauthentisch wahrnimmt. Besonders in sensiblen Kontexten, wie beispielsweise bei journalistischen Berichten, wissenschaftlichen Arbeiten oder offiziellen Schreiben, ist die Glaubwürdigkeit von zentraler Bedeutung. Ein einheitlicher Stil trägt wesentlich dazu bei, das Vertrauen der Leser zu stärken.
Die unterschiedlichen Schreibstile
Es gibt eine Vielzahl von Schreibstilen, die je nach Zielgruppe, Textsorte und beabsichtigter Wirkung eingesetzt werden. Die Wahl des Schreibstils hat direkten Einfluss darauf, wie ein Text wahrgenommen wird und welche Wirkung er auf den Leser hat. Im Folgenden werde ich verschiedene Schreibstile vorstellen und anhand von Beispielen verdeutlichen, wie sie sich in der Praxis auswirken.
Der journalistische Schreibstil
Der journalistische Schreibstil ist auf Verständlichkeit und Schnelligkeit ausgelegt. Er wird oft verwendet, um Nachrichten und aktuelle Ereignisse zu berichten. Der journalistische Stil ist direkt, prägnant und oft in der Wendungsweise kürzer als der wissenschaftliche Stil. Er verwendet eine klare und einfache Sprache, um eine breite Leserschaft anzusprechen.
Beispiel: „In einer überraschenden Wendung hat das Parlament heute das umstrittene Gesetz zur Reform des Gesundheitssystems verabschiedet. Der Gesetzesentwurf, der in den vergangenen Wochen heftige Debatten ausgelöst hatte, wird nun voraussichtlich Anfang nächsten Monats in Kraft treten.“
Der journalistische Stil verwendet häufig die Pyramidenstruktur (wichtigste Information zu Beginn, Details folgen), um die Hauptpunkte schnell zu erfassen.
Der kreative Schreibstil
Der kreative Schreibstil wird in der Literatur und in künstlerischen Texten verwendet. Hier geht es weniger um Fakten, sondern um die Ausdruckskraft, die Schaffung von Atmosphären und die Entwicklung von Charakteren. Der kreative Stil kann vielfältige Sprachbilder wie Metaphern, Vergleiche und Personifikationen nutzen.
Beispiel: „Die Sonne kämpfte sich mühsam durch die Wolken, als wollte sie der Dunkelheit trotzen. Ein kalter Wind blies über das Meer, der die Wellen in eine tiefe Melancholie versetzte.“
Dieser Stil ist reich an Emotionen und Bildern und ermöglicht es, tiefe Stimmungen zu erzeugen oder eine Geschichte lebendig werden zu lassen. Er ist häufig in Romane, Gedichte oder Erzählungen zu finden.
Der informelle Schreibstil
Der informelle Schreibstil ist lockerer und persönlicher, sodass er Anwendung in der Alltagssprache und in der Kommunikation mit Freunden, in sozialen Medien oder in persönlichen Blogs findet. Der Ton kann humorvoll, freundlich oder entspannt sein.
Beispiel: „Hey Leute, heute war ein verrückter Tag! Ich bin fast zu spät zur Arbeit gekommen und dann hat auch noch mein Computer den Geist aufgegeben. Aber egal, jetzt genieße ich endlich einen Kaffee – der einzige Moment der Ruhe heute.“
Der informelle Stil verwendet oft einfache Satzstrukturen, um eine entspannte und persönliche Atmosphäre zu schaffen. Es ist die direkte Ansprache und häufig auch umgangssprachliche Ausdrücke zu finden.
Der werbliche Schreibstil
Der werbliche Schreibstil wird in der Werbung und im Marketing eingesetzt, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen oder zu bewerben. Der Fokus liegt darauf, den Leser zu einer Handlung zu bewegen (z. B. Kauf, Anmeldung). Der Stil ist meist emotional und überzeugend, oft mit dem Ziel, Bedürfnisse oder Wünsche zu wecken.
Beispiel: „Erleben Sie den ultimativen Genuss! Unser handgemachter Kaffee sorgt für den perfekten Start in den Tag – intensiv, aromatisch und frisch. Bestellen Sie jetzt und gönnen Sie sich den Luxus, den Sie verdienen!“
Der werbliche Stil nutzt überzeugende Sprache und positive Emotionen, um das Produkt in einem bestmöglichen Licht darzustellen und den Kunden zu einer Handlung zu bewegen.
Der technische Schreibstil
Der technische Schreibstil wird vor allem in Handbüchern, Bedienungsanleitungen, wissenschaftlichen oder technischen Dokumentationen verwendet. Er ist präzise, klar und stellt sicher, dass der Leser die Anweisungen oder Informationen leicht umsetzen kann. Fachbegriffe werden verwendet, aber immer mit dem Ziel, eine fehlerfreie und leicht verständliche Anleitung zu geben.
Beispiel: „Schritt 1: Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät. Achten Sie darauf, dass der Stecker fest eingesteckt ist. Schritt 2: Drücken Sie den Power-Knopf für drei Sekunden, bis das Gerät einen kurzen Piepton von sich gibt.“
Der technische Stil verzichtet auf emotionale oder ausschmückende Sprache und konzentriert sich darauf, dass der Text klare Handlungsanweisungen vermittelt.
Der humorvolle Schreibstil
Der humorvolle Schreibstil zielt darauf ab, den Leser zum Lachen zu bringen. Er wird oft in unterhaltenden Texten, Satiren oder Kolumnen verwendet. Der humorvolle Stil spielt häufig mit Ironie, Übertreibung und Wortspielen, um eine lockere, angenehme Stimmung zu erzeugen.
Beispiel: „Ich wollte meine Diät beginnen, aber der Kuchen hat mich einfach angefleht, ihn zu essen. Wie konnte ich ihm widerstehen? Jetzt nehme ich mir vor, morgen zu starten – ganz bestimmt.“
Der humorvolle Stil nutzt oft spielerische Sprache und witzige Wendungen, um den Leser zu unterhalten und die Stimmung zu heben.
Der wissenschaftliche Schreibstil
Der wissenschaftliche Schreibstil ist sachlich, präzise und objektiv. Er dient dazu, komplexe Informationen auf eine verständliche, überprüfbare und logische Weise zu präsentieren. Der Autor vermeidet persönliche Meinungen oder Emotionen und stützt sich auf Quellen und Belege.
Beispiel: „Die Ergebnisse dieser Untersuchung belegen, dass die Nutzung von sozialen Medien einen signifikanten Einfluss auf die akademische Leistung von Studierenden hat. Eine statistische Auswertung der Daten zeigt, dass die tägliche Nutzung von sozialen Netzwerken mit einer Verringerung der Studienzeiten korreliert.“
Dieser Stil ist faktenorientiert und verwendet Fachbegriffe, die für das Thema relevant sind. Er verfolgt das Ziel, eine objektive Analyse oder Erklärung zu liefern.
Der akademische Schreibstil
Der akademische Schreibstil ist eine spezielle Form des wissenschaftlichen Schreibens im universitären und hochschulischen Kontext. Er zeichnet sich durch eine formelle Sprache, detaillierte Argumentation und eine klare Struktur aus. Er verwendet oft Fachbegriffe und erwartet eine präzise Quellenangabe.
Beispiel: „Die vorliegende Studie untersucht den Einfluss von Ernährung auf die kognitive Leistungsfähigkeit bei Erwachsenen. Dabei wurde eine Querschnittsstudie durchgeführt, die auf einer Stichprobe von 500 Teilnehmern basiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine ausgewogene Ernährung einen positiven Einfluss auf die kognitive Leistung hat.“
Der akademische Stil verwendet oft lange Sätze, ist jedoch im Vergleich zum kreativen Stil eher nüchtern und formal.
Merkmale des wissenschaftlichen Schreibstils
Objektivität und Neutralität
Ein zentraler Aspekt des wissenschaftlichen Schreibens ist die Objektivität. Der Autor sollte sich möglichst neutral und sachlich ausdrücken, ohne persönliche Meinungen oder emotional gefärbte Ausdrücke einzubringen. Dies bedeutet, dass die Argumentation auf Fakten, Daten und belegbaren Quellen basieren muss. Subjektive Bewertungen oder persönliche Ansichten sind im wissenschaftlichen Schreiben unzulässig, es sei denn, sie sind als solche gekennzeichnet.
Präzision und Klarheit
Im wissenschaftlichen Schreibstil ist es entscheidend, sich präzise und genau auszudrücken. Vagheiten oder unklare Formulierungen sind zu vermeiden, da sie die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Textes beeinträchtigen können. Ein klarer Schreibstil ermöglicht es den Lesern, die Argumentation und die zugrundeliegenden Fakten problemlos zu folgen und nachzuvollziehen. Dazu gehört auch, die korrekte und eindeutige Verwendung von Fachbegriffen und technischen Ausdrücken.
Verwendung von Fachsprache
Wissenschaftliche Texte sind oft mit spezifischen Fachbegriffen ausgestattet, die den Kontext und die Disziplin des Textes präzise widerspiegeln. Die Verwendung von Fachsprache ist jedoch nicht nur eine Frage der Präzision, sondern auch ein Zeichen für die Zugehörigkeit zum Fachgebiet. Fachbegriffe sollten jedoch nicht übermäßig verwendet werden, sondern nur dort, wo sie für das Verständnis des Themas erforderlich sind. Ein zu stark technischer Jargon kann die Lesbarkeit erschweren, besonders für Leser außerhalb des Fachgebiets.
Struktur und Logik
Ein weiterer wichtiger Aspekt des wissenschaftlichen Schreibens ist die strukturierte und logische Anordnung des Textes. Wissenschaftliche Arbeiten folgen in der Regel einem festen Aufbau, der den Leser durch die Argumentation führt. Dazu gehören eine klare Einleitung, in der das Thema und die Forschungsfrage definiert werden, sowie ein strukturierter Hauptteil, der die Methodik, Ergebnisse und Diskussion der Forschung darstellt. Am Ende folgt eine prägnante Schlussfolgerung, die die Ergebnisse zusammenfasst und möglicherweise einen Ausblick auf zukünftige Forschungen gibt.
Zitationsweise und Quellenangaben
Wissenschaftliches Schreiben lebt von der Zitierfähigkeit. Alle verwendeten Quellen müssen ordnungsgemäß angegeben und im Text referenziert werden. Dies stellt sicher, dass die Aussagen des Autors auf überprüfbare und nachvollziehbare Informationen zurückführbar sind. Je nach Fachgebiet und akademischer Disziplin gibt es unterschiedliche Zitationsstile, wie beispielsweise den APA-Stil, MLA-Stil oder Chicago-Stil, die klare Richtlinien für die Quellenangabe festlegen.
Formell und ohne persönliche Ansprache
Im wissenschaftlichen Schreiben wird in der Regel die formelle Anrede und der vermeintlich objektive Duktus verwendet. Das bedeutet, dass der Autor möglichst neutral und ohne persönliche Ansprache wie “Ich” oder “Wir” schreiben sollte. Vereinzelt kann der Autor in einigen Disziplinen, wie etwa in den Sozialwissenschaften, jedoch auch eine erste Person (“Ich”) verwenden, um seine eigene Perspektive darzustellen. Generell gilt jedoch, dass der wissenschaftliche Stil eine gewisse Distanz zu persönlichen Meinungen oder Emotionen wahren sollte.
Wissenschaftlicher vs. akademischer Schreibstil
| Kriterium | Wissenschaftlicher Schreibstil | Akademischer Schreibstil |
| Zielsetzung | Vermittlung von Fakten und Forschungsergebnissen. | Analyse, Diskussion und kritische Reflexion von Themen oder Fragestellungen. |
| Ton | Objektiv, neutral, faktenbasiert. | Formell, präzise, argumentativ und oft tiefgehend. |
| Sprache | Sachlich, präzise, oft nüchtern. | Formelle, komplexere Struktur mit ausführlicher Argumentation. |
| Verwendung von Quellen | Betonung auf genaue Quellenangabe und Datenbelege. | Quellenangabe ist ebenfalls wichtig, aber stärker in Diskussion und Theorie eingebunden. |
| Zielgruppe | Fachleute, Experten und die wissenschaftliche Gemeinschaft. | Studierende, Dozenten und akademische Leser in spezialisierten Bereichen. |
| Struktur | Klar, logisch und systematisch; häufig in Abschnitte und Unterabschnitte unterteilt. | Komplexer und oft mehrschichtiger; beinhaltet umfassende Diskussion und Reflexion. |
| Länge | Kann kürzer und prägnanter sein, insbesondere bei wissenschaftlichen Artikeln. | Oft länger und detaillierter, da mehr Hintergrund, Kontext und Argumente eingebaut werden. |
| Beispiele | Forschungspapiere, Fachartikel, empirische Studien. | Essays, Dissertationen, Abschlussarbeiten, wissenschaftliche Essays. |
| Verwendung von Fachbegriffen | Häufige Nutzung von fachspezifischen Begriffen und Jargon. | Verwendet auch Fachbegriffe, jedoch häufig stärker kontextualisiert und theoretisch eingebunden. |
| Ziel der Darstellung | Vermittlung von objektiven Fakten und Ergebnissen. | Ziel ist es, eine tiefgehende, kritische Auseinandersetzung mit einem Thema zu fördern. |