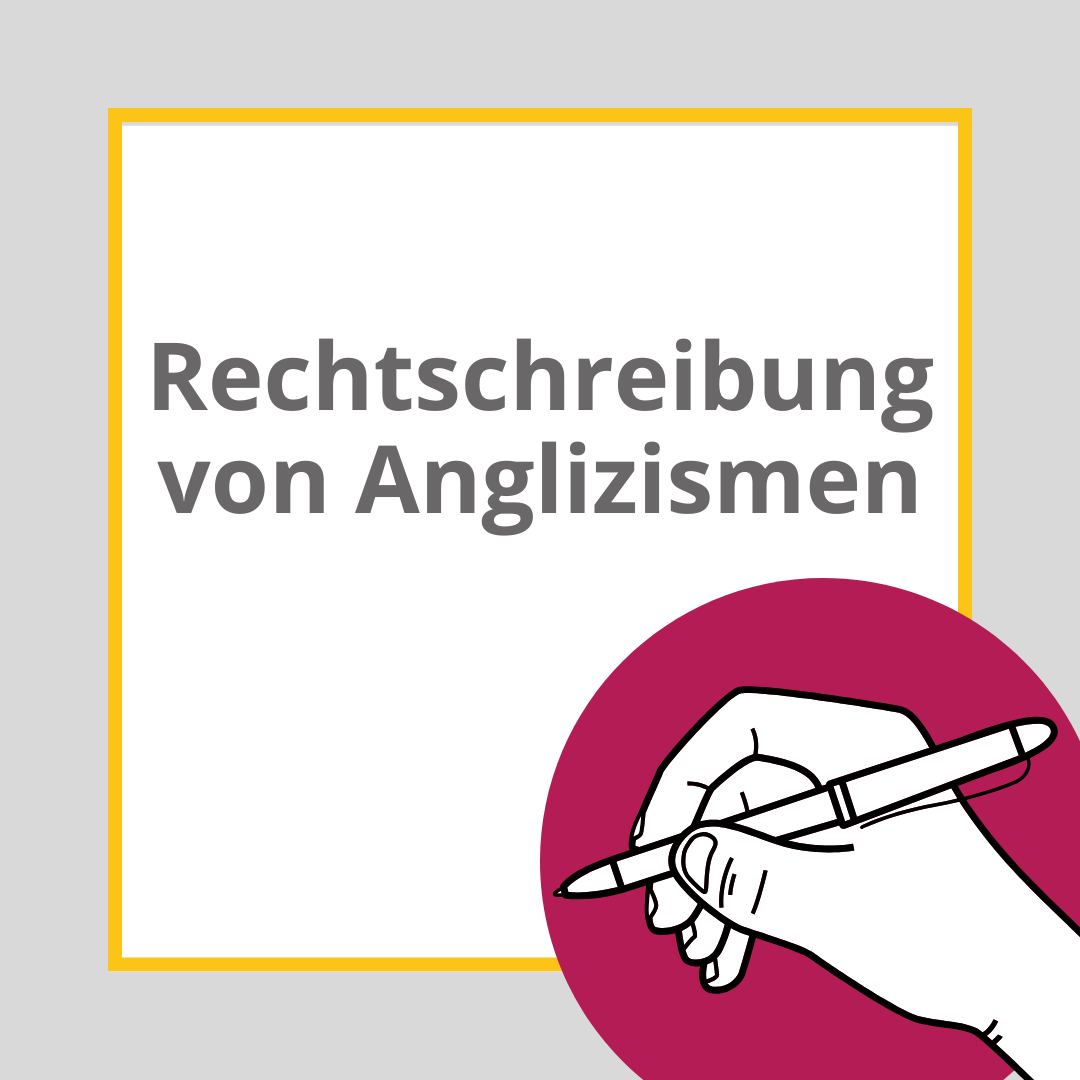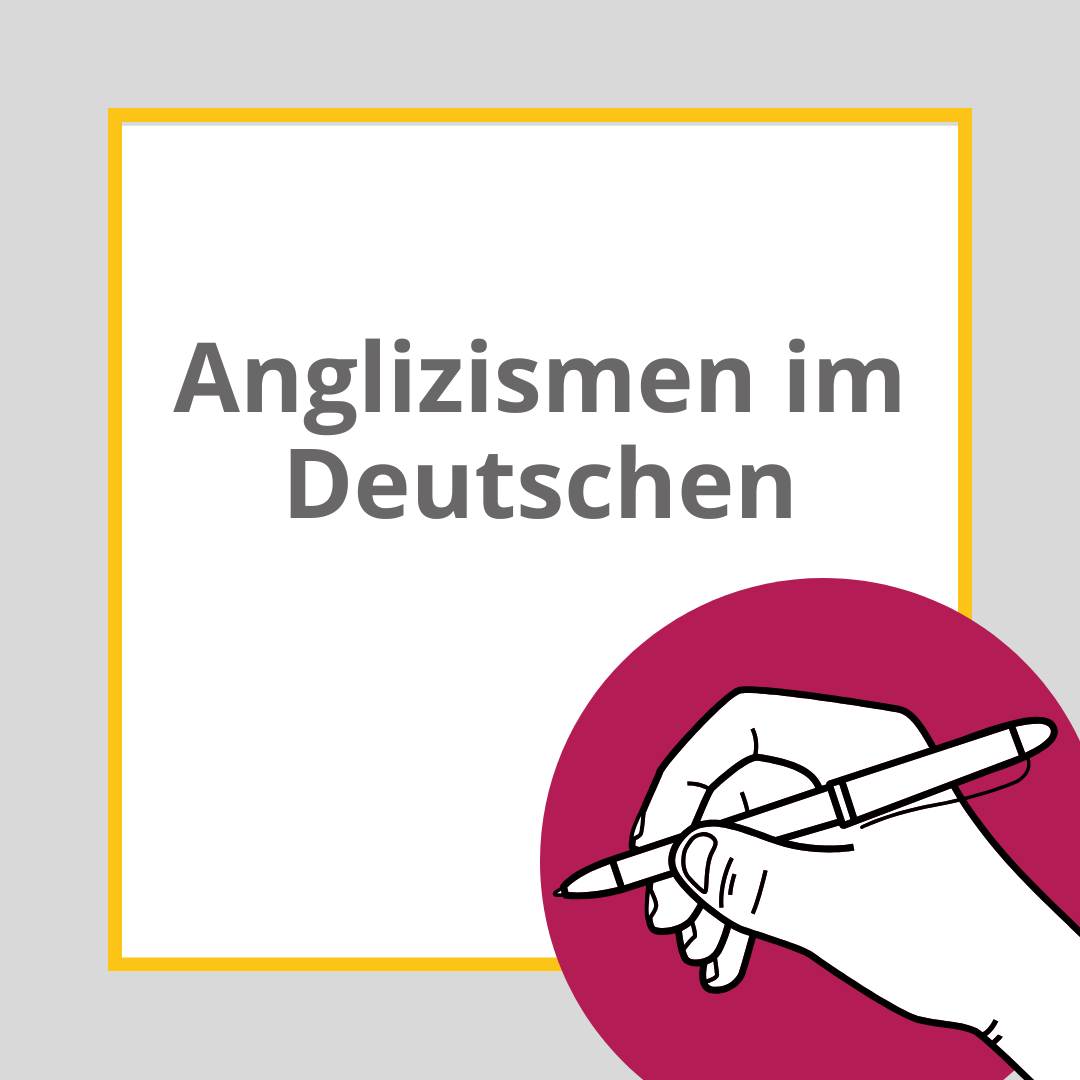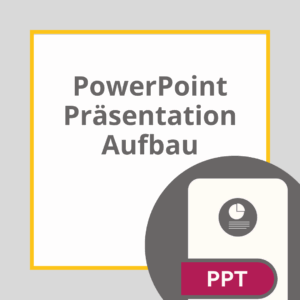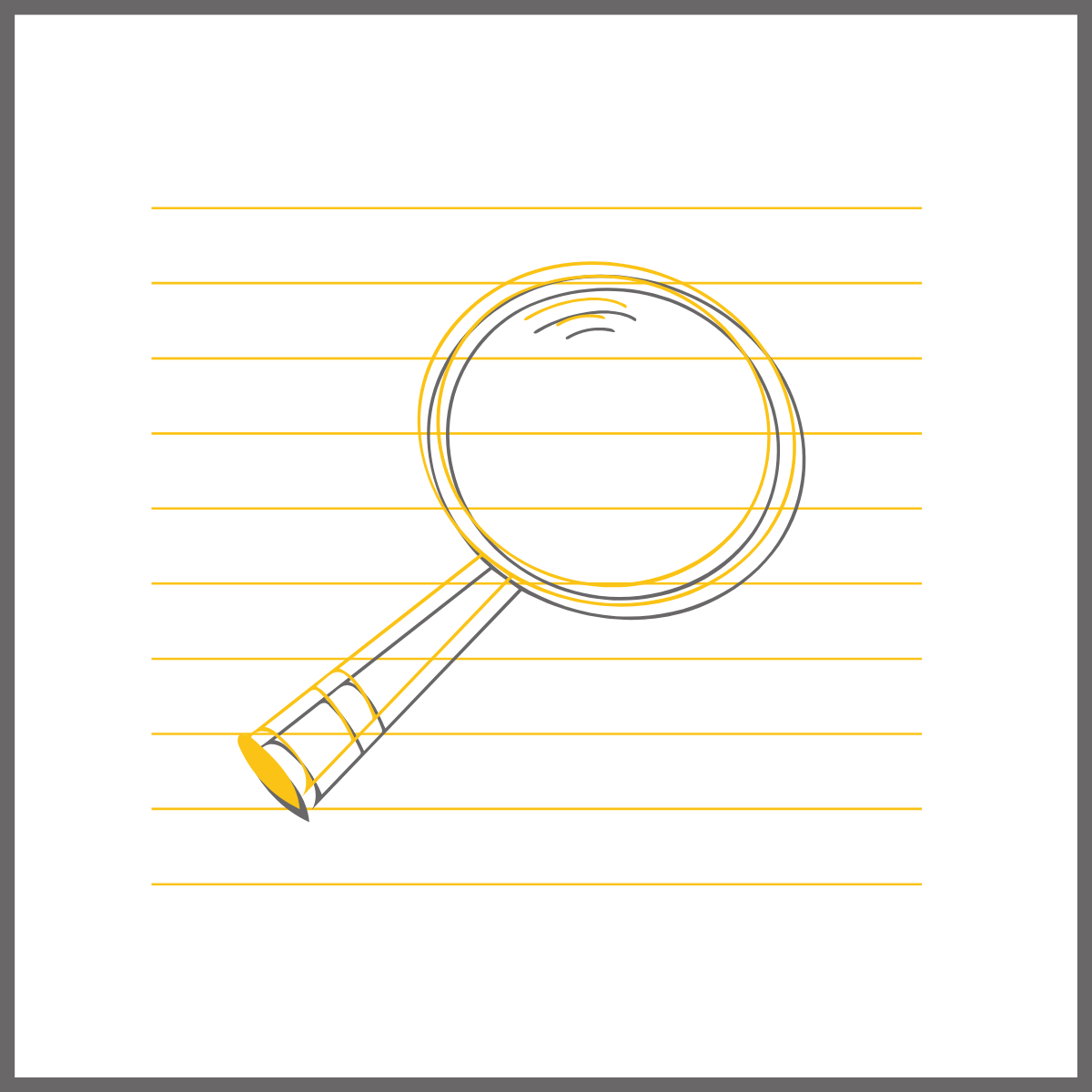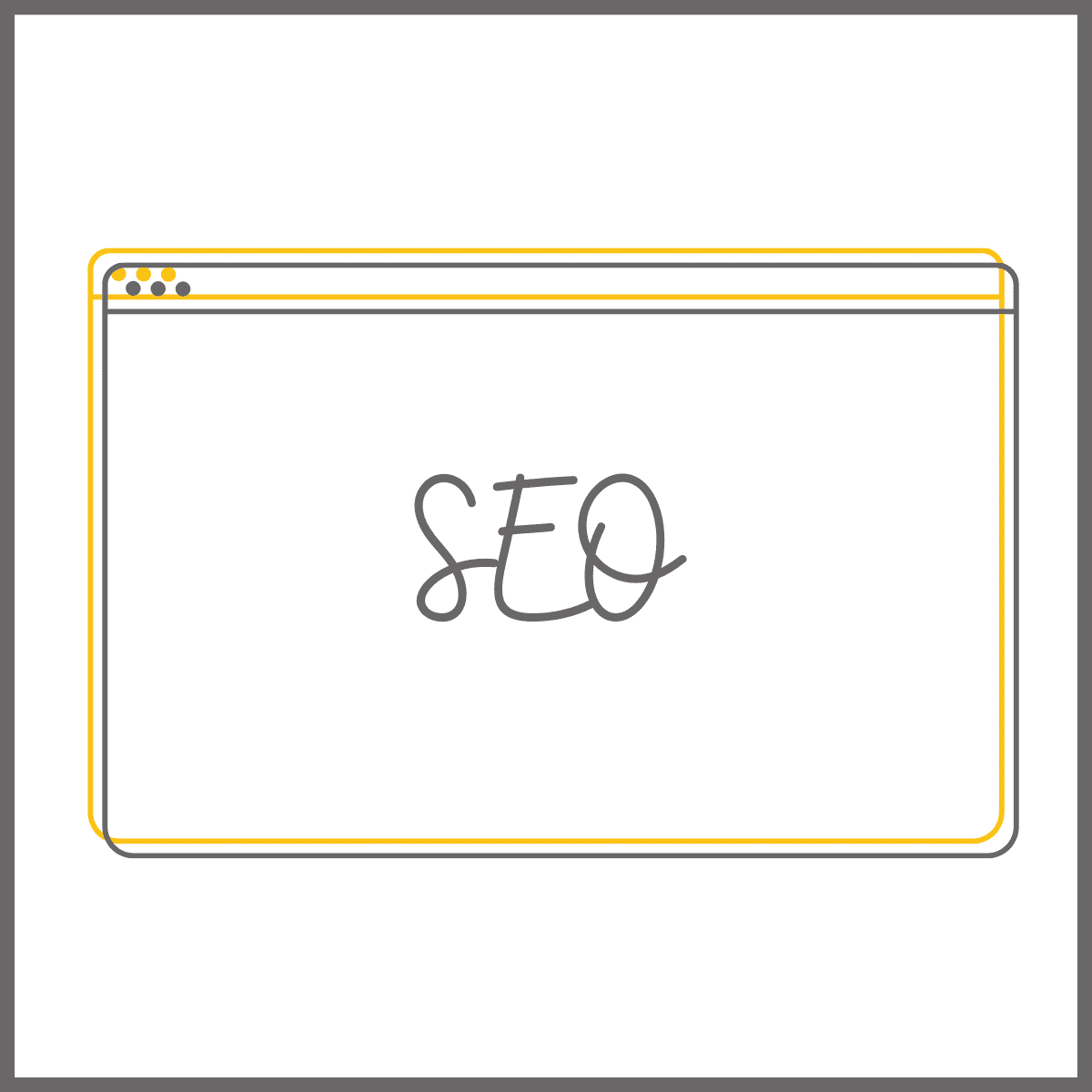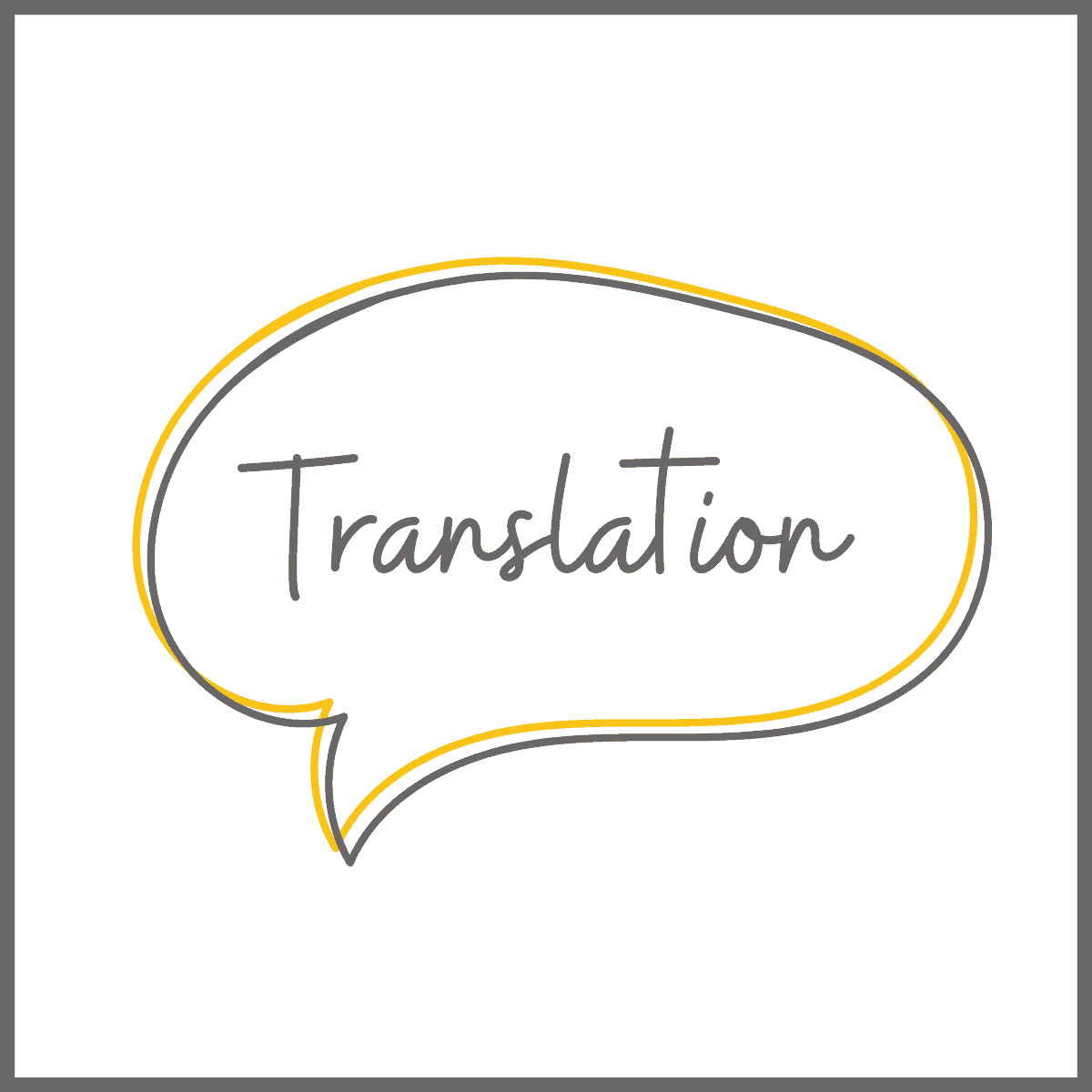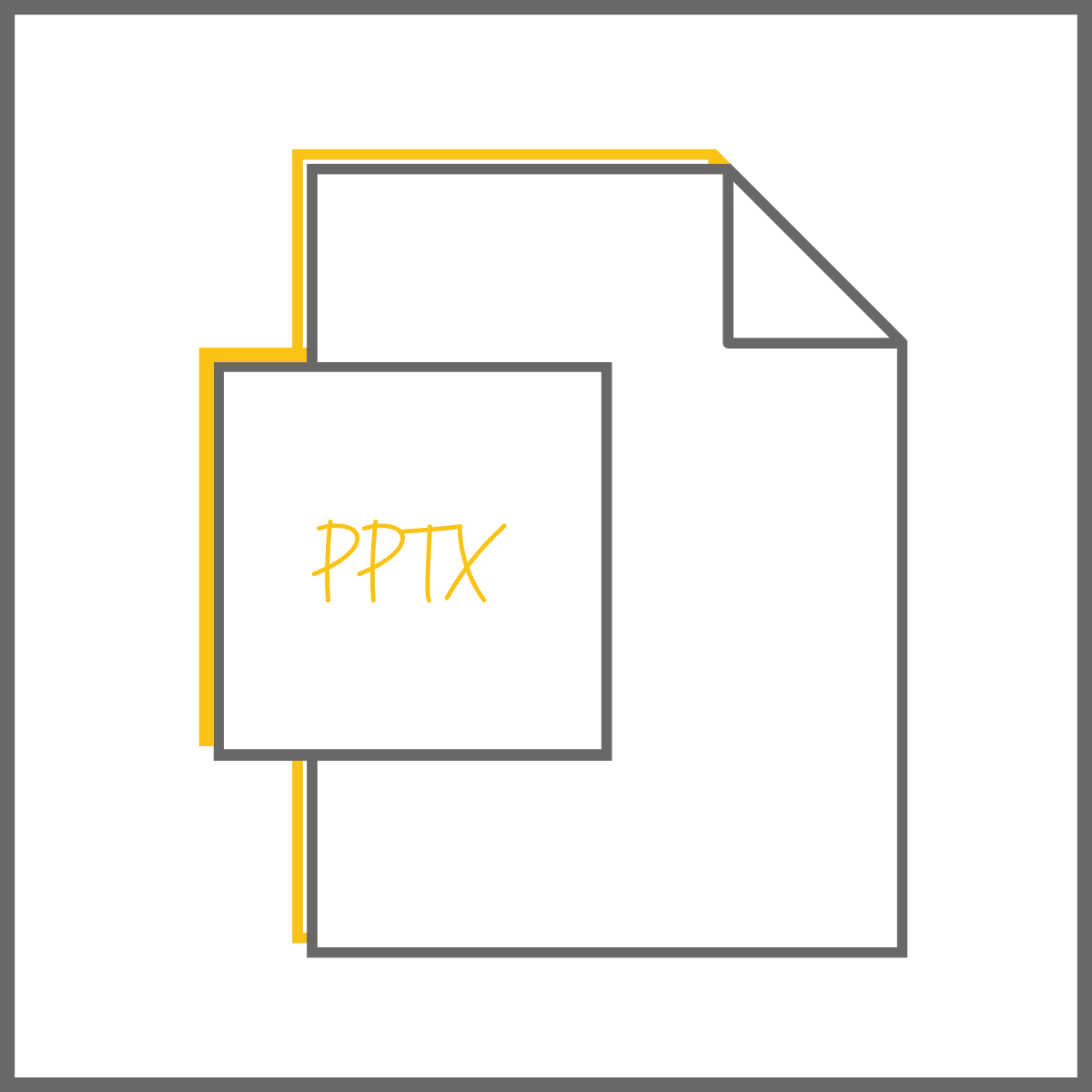Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um ein Analyseverfahren, das es ermöglicht, jegliche Art von Kommunikation systematisch auszuwerten. Ursprünglich stammt dieses Verfahren aus der Kommunikationswissenschaft und findet heute in verschiedenen Wissenschaftsbereichen Anwendung, insbesondere aber in der qualitativen Sozialforschung.
Wir möchten hier zwei der gängigsten Analyseverfahren vorstellen. Dabei handelt es sich um die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und die Analyse nach Kuckartz.
Benötigst du Unterstützung bei deiner Bachelorarbeit?
Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring: Grundlagen
Mit der qualitativen Inhaltsanalyse lassen sich Dokumente, Texte und andere Materialien detailliert auswerten. Anhand dieser Auswertung tragen sie zur Beantwortung einer Forschungsfrage bei.
Mayring geht davon aus, dass jedes Dokument (hierzu zählen auch Bilder, Lieder, Texte usw.) ein komplexes Bedeutungssystem ist und dass er in kleinere Einheiten zerlegt werden kann. Ziel der Methode ist es daher, relevante Informationen zu extrahieren und in Kategorien zu ordnen, um sie besser interpretieren zu können.
Grundlegend ist bei der qualitativen Inhaltsanalyse die Einteilung eines Textes in Kategorien. Durch die Zuordnung der Kategorien zueinander lassen sich proportionale Beziehungen und Deutungsmuster aufdecken. Hierbei können entweder induktive oder deduktive Kategorien gebildet werden.
Was ist der Unterschied zwischen induktiv und deduktiv?
Die induktive bzw. deduktive Kategorienbildung spielt bei der qualitativen Inhaltsanalyse immer eine Rolle. Was genau sie bedeuten und worin der Unterschied liegt, zeigt folgender Vergleich:
Induktiv | Deduktiv |
Ableitung einer eigenen Theorie | Testen einer bereits vorhandenen Theorie |
Fokus auf Zukunft | Fokus auf Gegenwart oder Vergangenheit |
Wenig Literatur vorhanden | Viel Literatur vorhanden |
Bei der induktiven Argumentation geht es darum, aus einer bestimmten Beobachtung eine generelle Aussage zu treffen. Das bietet sich vor allem dann an, wenn es noch nicht besonders viel Forschung und Literatur zu einem bestimmten Thema gibt.
Bei der deduktiven Argumentation handelt es sich um das genaue Gegenteil: Von einer allgemeinen Aussage ausgehend gilt es, bestimmte Aspekte zu untersuchen. Es gibt bereits viel Literatur zu einem Thema bzw. einer Theorie, die nun geprüft wird. Daraus entstehen in der Regel jedoch keine neuen Erkenntnisse.
Die beiden Forschungsmethoden lassen sich darüber hinaus auch kombinieren. Häufig werden induktive Studien von Wissenschaftlern noch einmal deduktiv hinterfragt, um Ihre Erkenntnisse zu bestätigen oder eben zu widerlegen.
Die fünf Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse
Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring beinhaltet fünf Schritte. Diese sollten befolgt werden, um einen Text oder anderes Kommunikationsmaterial systematisch auszuwerten.
Erster Schritt: Auswahl des Materials
Welches Material bietet sich zur Beantwortung deiner Forschungsfrage an?
Im ersten Schritt wählst du das Material, das für die Forschungsfrage relevant ist. Hierzu können neben klassischen Texten auch audiovisuelle Medien zählen. Folgendes Material kommt dafür in Frage:
- Zeitungsartikel
- Interviews
- Radiodokumentationen
- TV Beiträge
- Lieder und Liedtexte
Zweiter Schritt: Richtung der Analyse festlegen
Wer oder was ist das Ziel der Analyse?
Hier legst du fest, was genau der Gegenstand deiner Analyse ist. Möglich wäre hier beispielsweise:
- das Medium selbst
- der Verfasser des Mediums
- die Zielgruppe
- der historische Hintergrund des Mediums
Dritter Schritt: Form der Analyse wählen
Welche der drei Formen passt zu deiner Forschungsfrage?
Je nach Forschungsfrage macht eine der drei möglichen Analyseformen Sinn.
- Zusammenfassende Inhaltsanalyse
Diese Analyse ist sinnvoll, wenn Deine Forschungsfrage sich hauptsächlich mit inhaltlichen Aspekten des Mediums befasst. Hier reduzierst du das Material auf einen kleinen, überschaubaren Teil. So erhältst du einen Überblick über relevante Aussagen.
- Explizierende Inhaltsanalyse
Bei der explizierenden Analyse betrachtest du den gesamten Text, beziehungsweise das gesamte Medium. Sollte es Wissenslücken oder Unklarheiten im Text geben, ziehst du weitere Informationen heran. Hierbei musst du eine sorgfältige Quellenanalyse deiner verwendeten Quellen durchführen.
- Strukturierende Inhaltsanalyse
Bei der strukturierenden Inhaltsanalyse musst du vorab Kriterien entwickeln, nach denen du deine Medien bewertest. Diese Kriterien müssen festgeschrieben werden und für die Auswertung eines jeden Mediums gelten.
Vierter Schritt: Interpretation der Ergebnisse
Was sagen meine Ergebnisse aus?
Um die Ergebnisse zu interpretieren, bedarf es vorher natürlich einer genauen Festlegung von Kategorien, die du für deine Forschungsfrage betrachten musst. Es ist wichtig klar zu machen, welcher Teil eines Mediums in welche Kategorie fällt.
Fünfter Schritt: Sicherstellung der Gütekriterien
Werden alle Gütekriterien erfüllt?
Abschließend müssen die Ergebnisse überprüft und validiert werden. Hierbei solltest du auf folgende Punkte achten:
- Transparenz: Ist es für den Leser ersichtlich, wie du vorgegangen bist? Hast du die Gründe für deine Medienauswahl klargemacht?
- Objektivität: Ist dein Ergebnis nicht subjektiv? Würde ein anderer Forscher bei derselben Vorgehensweise zu einem ähnlichen Schluss kommen?
- Reproduzierbarkeit: Würdest du bei einer erneuten Auswertung der Medien erneut zu deinem Ergebnis kommen? Hast du die Kategorien für alle Medien gleich angewandt?
Die Analyse nach Kuckartz: Unterschiede und Grundlagen
Zunächst einmal sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass es keine gravierenden Unterschiede im Ablauf der beiden Auswertungsverfahren gibt. Die Basis beider Analyseverfahren ist die Zuordnung eines Textes in bestimmte Kategorien.
Hierbei unterteilt Kuckartz darüber hinaus in folgende Kategoriearten:
- Fakten (möglichst objektive Gegebenheiten)
- Thema / Inhalt (Textstellen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen)
- Evaluative Kategorien (Material wird hier bereits bewertet und in eine Reihenfolge gebracht)
- Analytische oder Thematische Kategorien (Passagen, die auf einer bestimmten theoretischen Konzept beruhen)
- Natürliche Kategorie (Kategorien, die nach Begriffen gebildet werden, die im Medium selbst gebildet wurden, facettenreiche und plastische Kategorisierung)
- Formale Kategorien (Daten und Informationen)
MAXQDA
Die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz wurde ziemlich genau 30 Jahre nach Mayring veröffentlicht und baut dementsprechend auch auf dessen Arbeit auf. Kuckartz ist außerdem Erfinder der QDA-Software MAXQDA, weshalb sich seine Arbeitsschritte eher an der Software orientieren. Es handelt sich bei der Inhaltsanalyse nach Kuckartz also um eine Modernisierung der qualitativen Inhaltsanalyse.
MAXQDA ist eine Software, die speziell für die qualitative, computergestützte Datenanalyse entwickelt wurde. Sie hilft bei der Auswertung von qualitativen Interviews oder anderen Daten.
“Computergestützte Datenanalyse” beschreibt die Verwendung von Software, um Forscher bei der Interpretation und Auswertung von Datensätzen zu unterstützen. Nach der Analyse der Daten lassen sich Schlüsse und Theorien über das jeweilige Thema der Studie (z. B. aus Interviewdaten) ziehen.
Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz
Ein weiterer Unterschied bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz besteht darin, dass sich diese mehr an der Grounded Theory orientiert. Folgende Schritte sind bei der Inhaltsanalyse nach Kuckartz relevant:
Erster Schritt: Auswahl des Textes und Transkription
Hierbei markierst du relevante Inhalte. Du notierst ebenso erste Besonderheiten und es folgt eine kurze Fallzusammenfassung eines jeden Dokumentes.
Zweiter Schritt: Offenes Kodieren
Nun solltest du Textausschnitte, die sich auf bestimmte Themen beziehen, markieren und mit einem Code versehen. Hierfür solltest du ca. 10 – 20 % des Materials durcharbeiten. Die Hauptthemen kannst du aus der Forschungsfrage ableiten, jedoch können möglicherweise weitere Hauptthemen dazu kommen. Die Kategorien leitest du aus den Daten selbst ab und legst sie nicht vorab fest.
Dritter Schritt: Kodieren mit den Hauptkategorien
Nun teilst du den gesamten Text in eine der Hauptkategorien ein. Das geschieht Zeile für Zeile.
Vierter Schritt: Zusammenstellen der Medien
In einem nächsten Schritt wählst du die relevantesten Hauptkategorien aus und trägst die entsprechenden Textstellen zusammen.
Fünfter Schritt: Bestimmen von Subkategorien
Die Materialien einer Kategorie werden nun erneut analysiert. Du suchst nach zusätzlichen Subkategorien, um das Material weiter zu ordnen.
Sechster Schritt: Kodierung
Anhand des im fünften Schritt erfolgten Kategoriensystems kodiert du nun das gesamte Material.
Siebter Schritt: Analyse und Visualisierung
Im letzten Schritt analysierst du die Kategorien erneut. Du bestimmst Zusammenhänge zwischen den Kategorien und visualisiert deine Ergebnisse.
Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz handelt es sich um eine iterative Methode. Das bedeutet, die Analyse wird mehrmals durchlaufen, um die Ergebnisse zu verfeinern und zu verbessern.