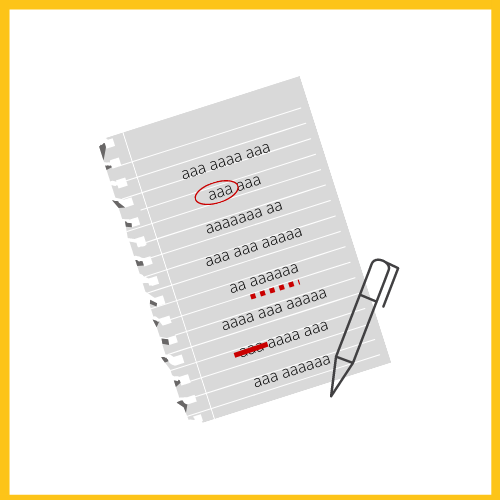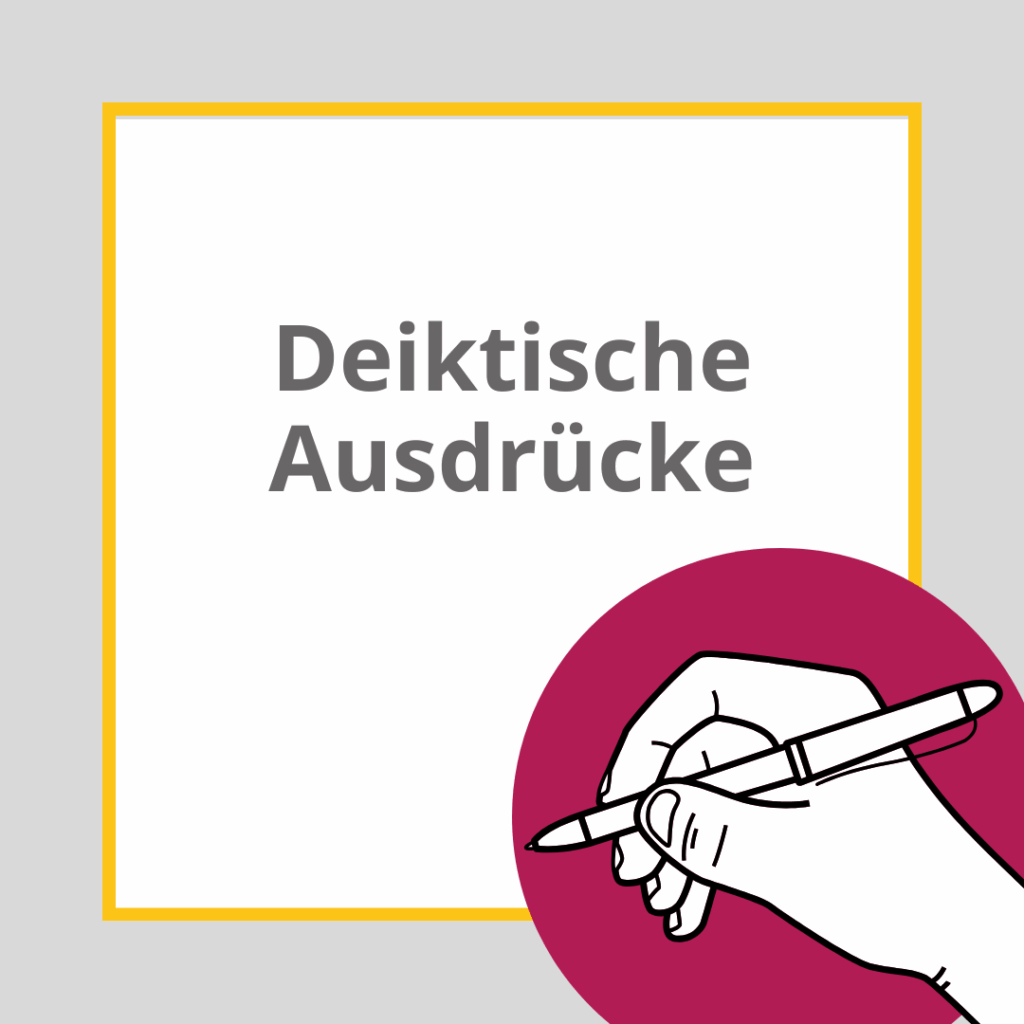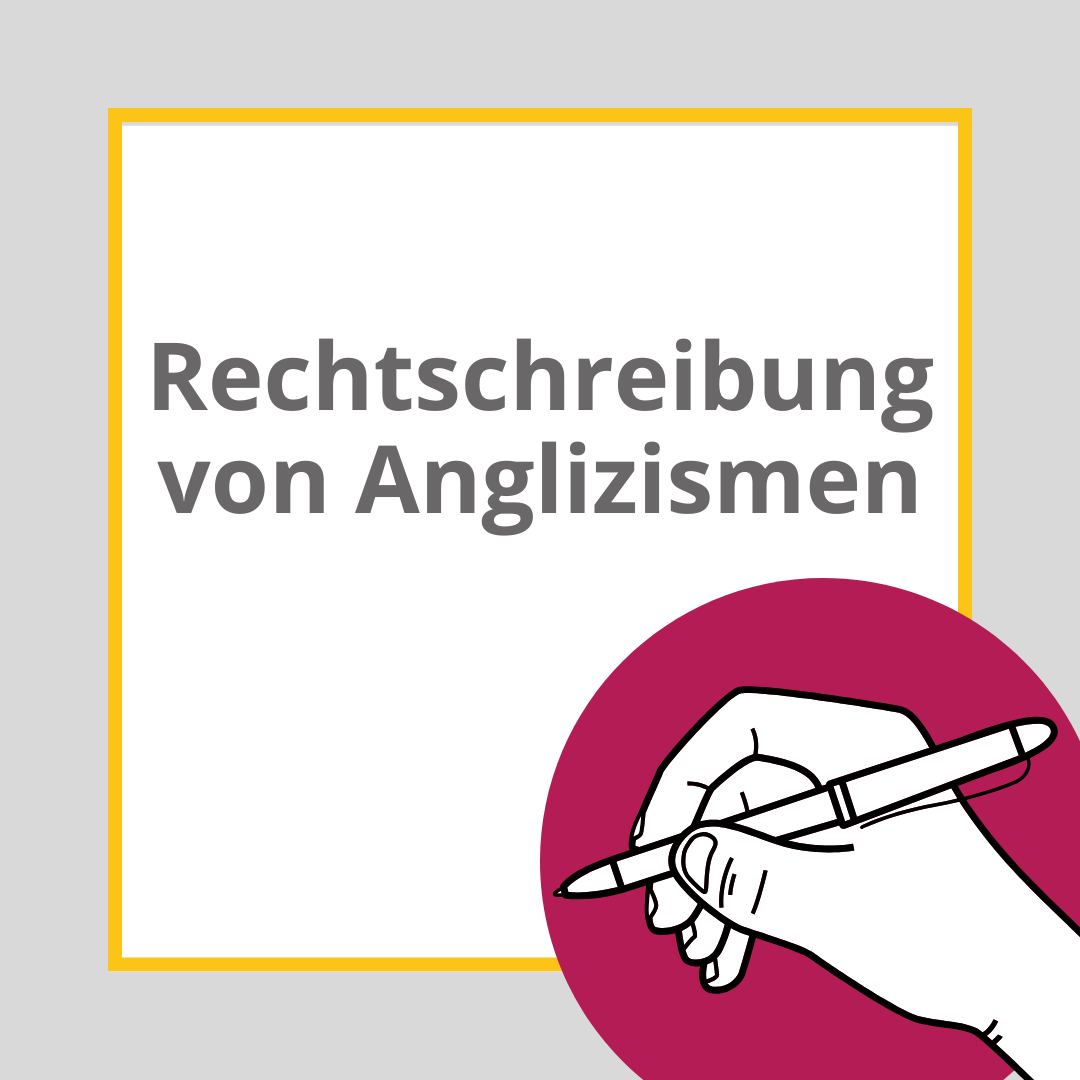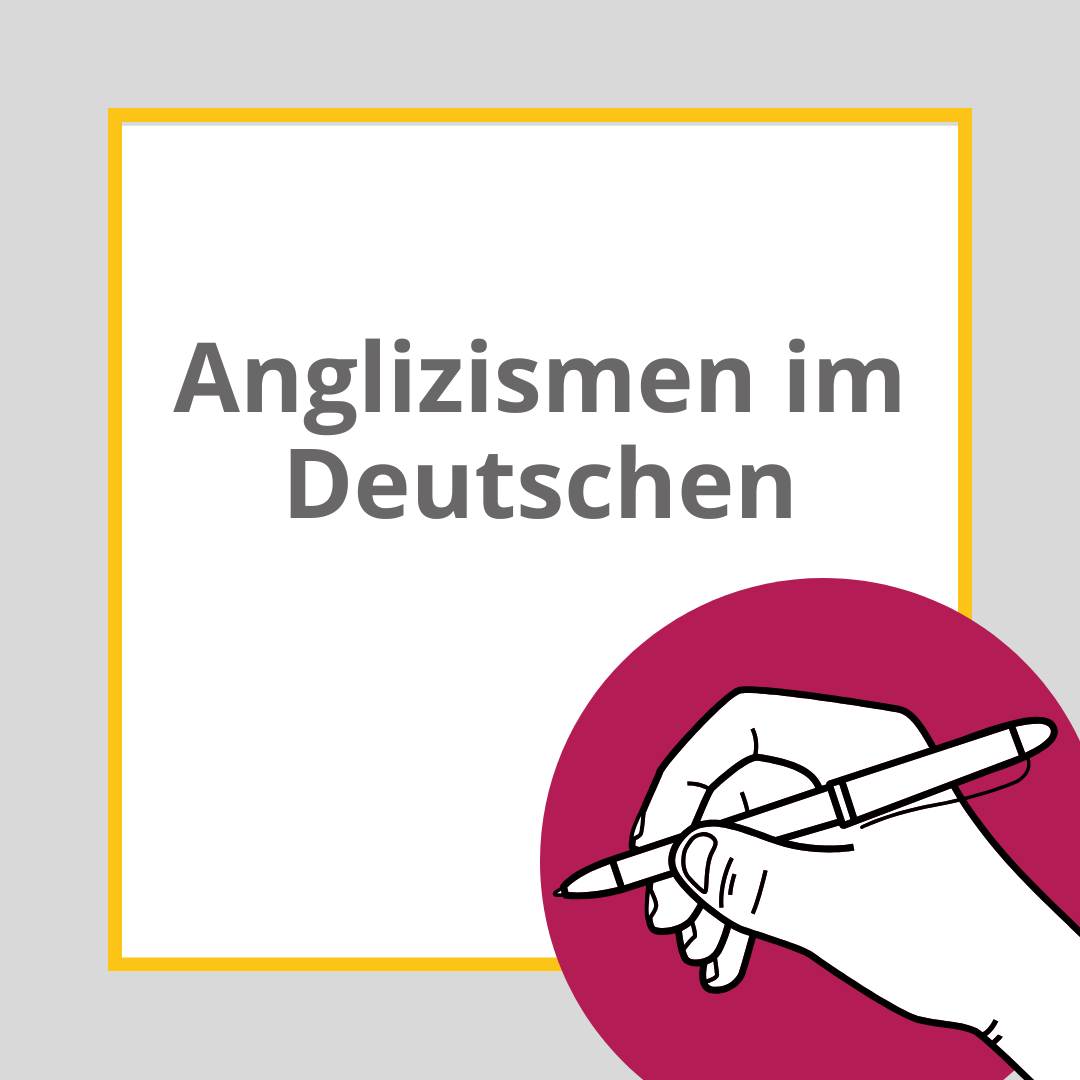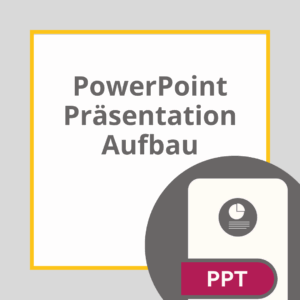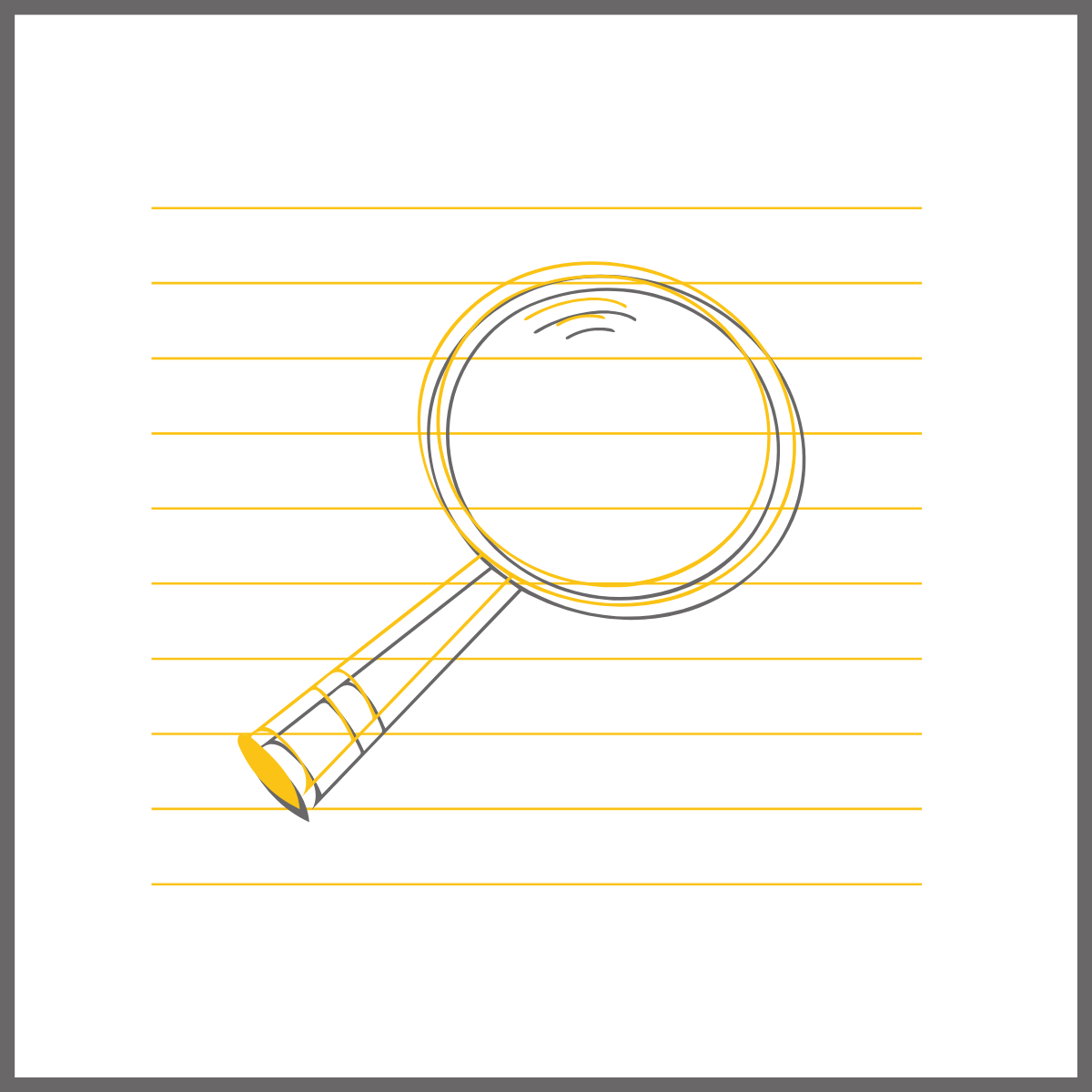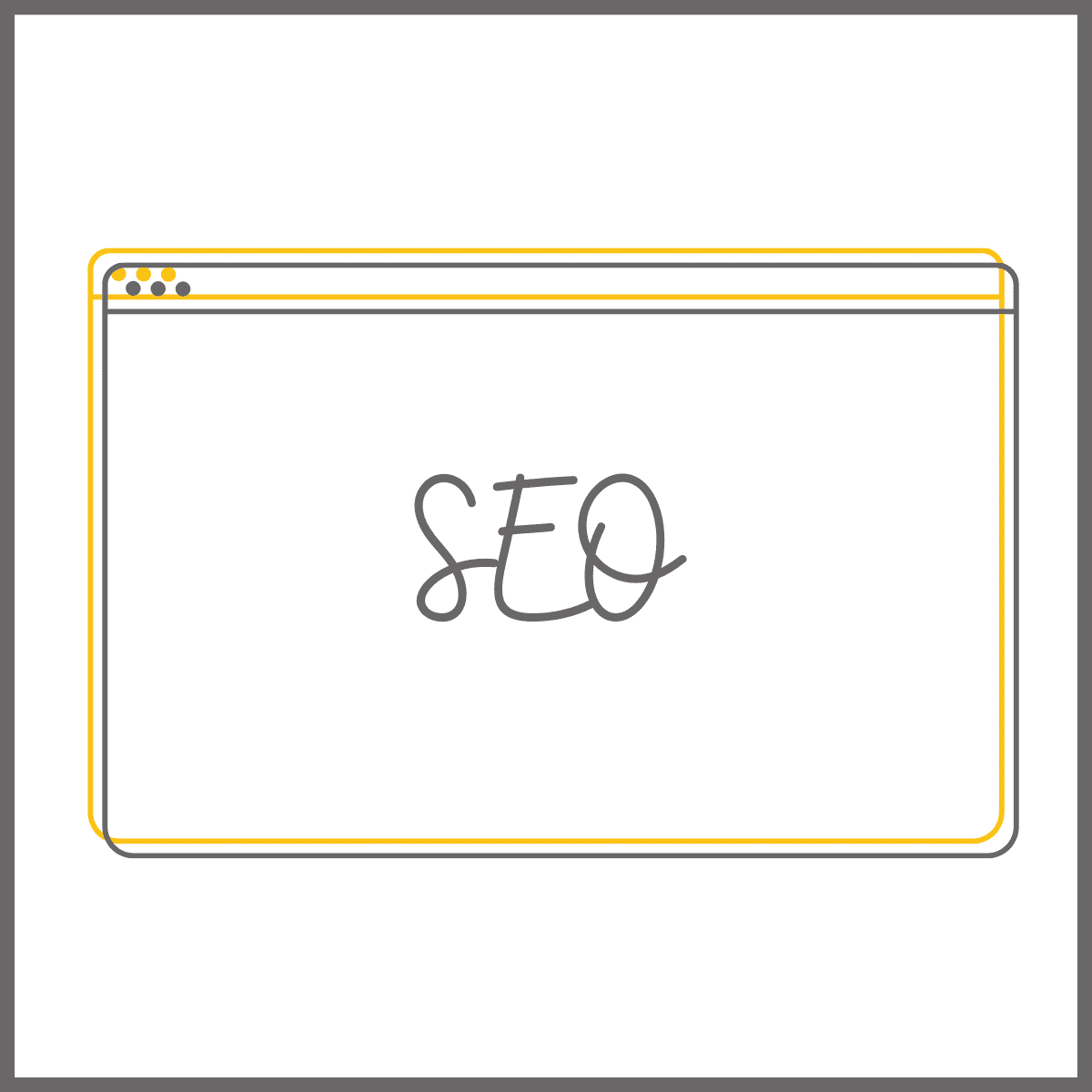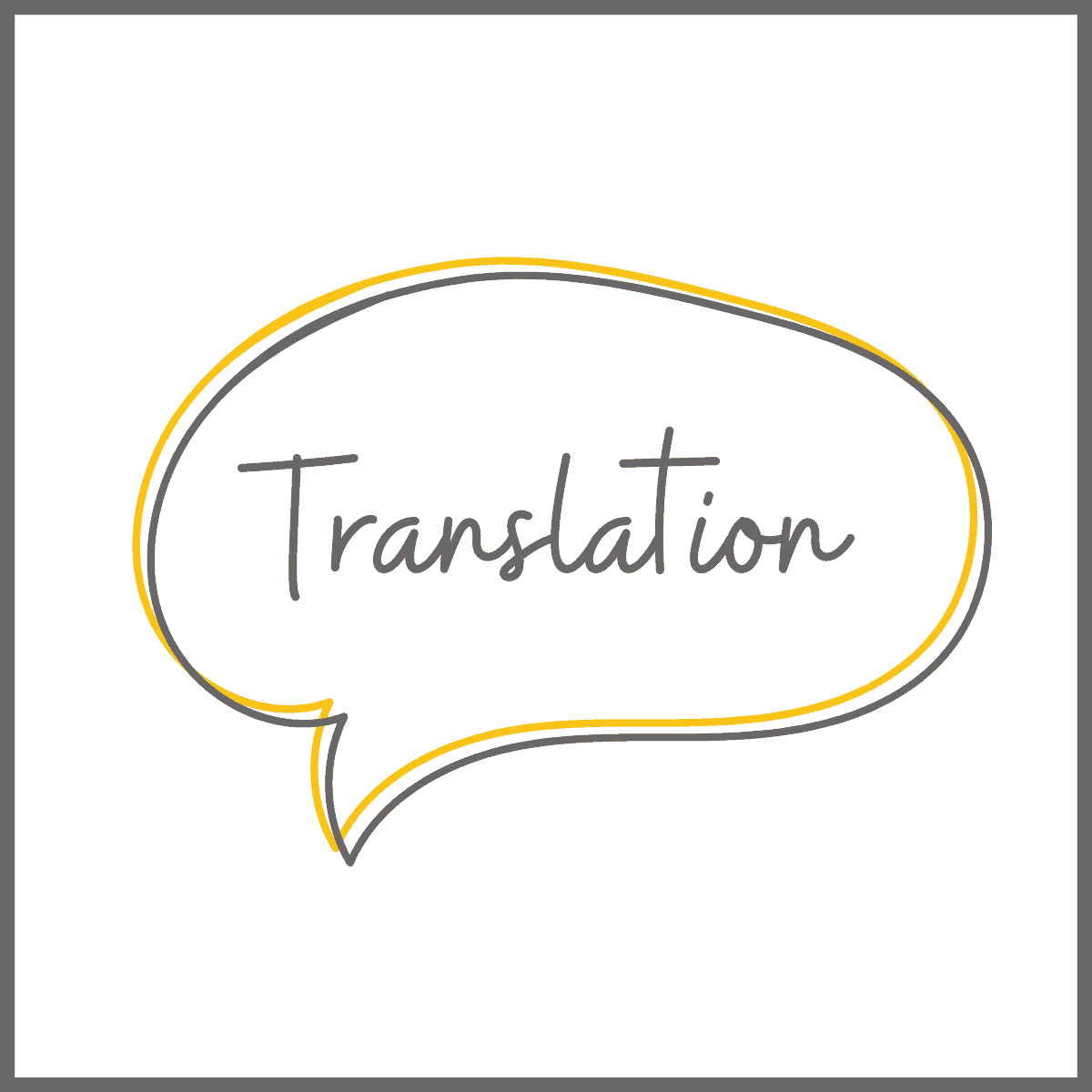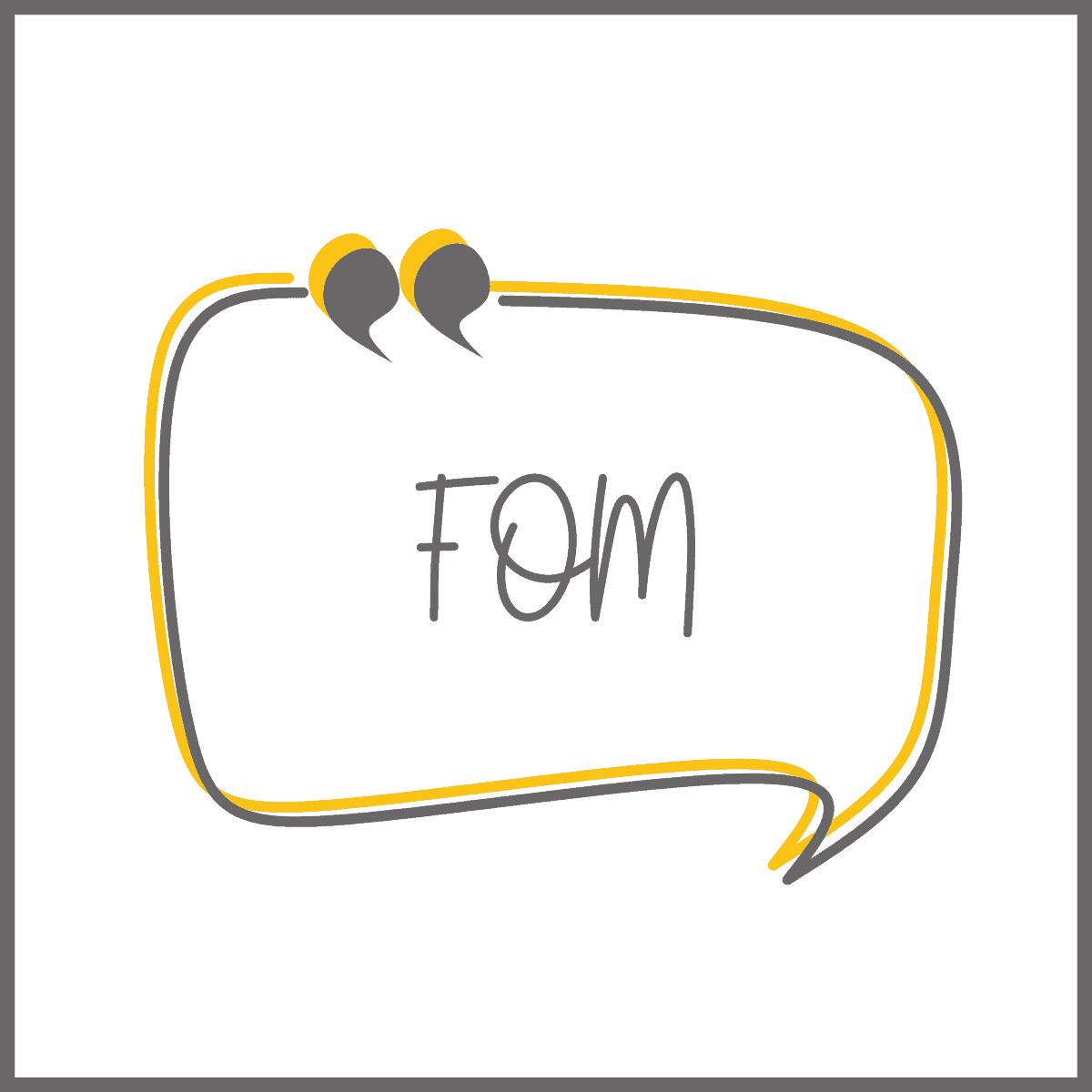Deiktische Ausdrücke sind für die menschliche Kommunikation unverzichtbar – sie verweisen auf Personen, Orte, Zeiten oder andere Kontextfaktoren und erhalten ihre Bedeutung erst durch den Kontext. Ohne diesen Kontext bleiben Formulierungen wie „hier“, „jetzt“ oder „du“ unbestimmt oder mehrdeutig. In der Sprachwissenschaft bezeichnet man solche kontextgebundenen Verweise als Deixis; die Wörter selbst, die diesen Bezug herstellen, heißen Deiktika oder deiktische Ausdrücke.
Dieser Fachartikel bietet eine wissenschaftlich fundierte, aber verständliche Übersicht über Deiktika in der deutschen Sprache. Wir befassen uns mit der Definition und Klassifikation deiktischer Ausdrücke, den verschiedenen Typen von Deixis (personale, temporale, lokale, soziale und textuelle Deixis) und liefern konkrete Beispiele aus dem Deutschen. Zudem wird erläutert, wie durch Deiktika Vagheit entstehen kann und welche Strategien es gibt, Vagheit zu vermeiden, indem man präzise Bezugnahmen verwendet. Abschließend wird die Bedeutung eines klaren Bezugswortes hervorgehoben – also warum es für effektive Kommunikation essenziell ist, dass stets klar ist, worauf sich ein deiktischer Ausdruck bezieht.
Definition und Klassifikation deiktischer Ausdrücke
In der Linguistik versteht man unter Deixis (von griechisch deíxis „Zeigen, Hinweis“) die Fähigkeit bestimmter sprachlicher Ausdrücke, ihre Referenz nur im Bezug auf die Äußerungssituation zu entfalten. Ein deiktischer Ausdruck verweist also auf etwas, das erst durch Informationen der Kommunikationssituation identifiziert werden kann.
Das Orientierungszentrum „Ich-hier-jetzt“
Zentral dafür ist das so genannte Orientierungszentrum oder die „Ich-hier-jetzt-Origo“: Wer spricht (Person), wo wird gesprochen (Ort) und wann (Zeitpunkt). Diese Parameter bilden den Bezugspunkt, vor dem deiktische Ausdrücke interpretiert werden müssen. Ohne Kontext bleiben Deiktika oft unverständlich.
Beispiel: Das Wort „hier“ verändert seinen konkreten Referenzort je nach Standort des Sprechers. Sagt jemand in Berlin „Ich bin hier“, so bezieht sich hier auf Berlin; in München würde „hier“ entsprechend München meinen. Ähnlich verhält es sich mit „jetzt“ oder „ich“. Wörter wie hier, dort, jetzt, gestern, ich, du etc. erhalten ihre genaue Bedeutung erst im jeweiligen Kommunikationskontext. Fehlt dieser Kontext, können solche deiktischen Ausdrücke mehrdeutig sein oder ihre präzise Bedeutung verlieren.
Fünf Haupttypen der Deixis
Man unterscheidet verschiedene Arten von Deixis, je nachdem, welcher Aspekt des Kontextes angesprochen wird:
Personendeixis: Verweis auf Kommunikationsbeteiligte
Lokaldeixis: Verweis auf Orte oder räumliche Verhältnisse
Temporaldeixis: Verweis auf Zeitpunkte oder Zeitspannen
Soziale Deixis: Verweis auf soziale Rollen oder Beziehungen
Textdeixis: Verweis auf sprachliche Einheiten innerhalb des Textes selbst
Personendeixis: Bezug auf Sprecher und Hörer
Die personale Deixis betrifft Pronomen und Ausdrücke, die auf die an einer Kommunikation beteiligten Personen verweisen. Im Deutschen sind dies vor allem die Personalpronomen der ersten Person (ich, wir) für den Sprecher und der zweiten Person (du, ihr, Sie) für den/die Angesprochenen. Hinzu kommen Pronomen der dritten Person (er, sie, es), die sich auf Dritte außerhalb der Gesprächssituation beziehen.
Beispielhafte Anwendung und mögliche Mehrdeutigkeiten
Beispiel: Wenn jemand sagt „Ich erkläre es dir später.“, muss aus dem Kontext erschlossen werden, wer mit „ich“ und „dir“ gemeint ist. Der Hörer muss wissen, wer gerade spricht und wer angesprochen wird. Bei der dritten Person entsteht häufig Mehrdeutigkeit.
Beispiel: „Als Maria mit Anna sprach, sagte sie, …“ – Wer ist sie? Maria oder Anna? Solche Unklarheiten entstehen, wenn das Bezugswort fehlt oder mehrdeutig ist. Eine Umformulierung wie „Anna sagte, Anna habe Recht.“ schafft Klarheit.
Lokaldeixis: räumliche Bezugnahme
Lokale Deixis umfasst Ausdrücke, die Orte, Positionen oder Richtungen relativ zum Sprecher angeben. Dazu gehören im Deutschen etwa hier, dort, da, drüben oder dieser Ort.
Die Bedeutung des Sprecherstandorts
Beispiel: „Stell die Vase dort hin.“ – Ohne Kontext bleibt dort unverständlich. Ebenso: „Hier ist es sehr laut.“ – „hier“ verweist auf den Sprecherstandort. In schriftlicher Kommunikation kann dieser Bezug verloren gehen, da der Leser nicht dieselbe Perspektive teilt.
Das Konzept der Origo
Die Ortsdeixis zeigt, dass der Sprecher der Referenzpunkt ist. Diese Rolle der „Origo“ führt dazu, dass dieselben Ausdrücke (z. B. hier, dort) je nach Sprecherstandort verschiedene Bedeutungen annehmen können. Klarheit entsteht nur, wenn dieser Standort eindeutig ist.
Temporaldeixis: zeitliche Verankerung
Temporale Deixis verweist auf Zeitpunkte oder -spannen, die vom Sprechzeitpunkt abhängen. Beispiele sind jetzt, gleich, morgen, gestern.
Zeitbezug nur im Kontext eindeutig
Beispiel: „Wir treffen uns morgen.“ – Ohne das heutige Datum bleibt unklar, welcher Tag gemeint ist. Auch heute Abend, in drei Wochen, kürzlich sind nur sinnvoll, wenn der Zeitrahmen bekannt ist. In schriftlichen Texten ist es oft besser, feste Daten zu nennen (am 7. Mai 2025).
Relative Zeitangaben und Kodierungszeitpunkt
Temporale Deixis macht deutlich, wie sehr Zeitwahrnehmung sprachlich relativiert wird. Begriffe wie jetzt, dann, vorher brauchen immer ein Bezugswort, um verstanden zu werden.
Soziale Deixis: Anrede und soziale Rollen
Die soziale Deixis betrifft sprachliche Mittel, mit denen soziale Rollen, Beziehungen oder Hierarchien markiert werden. In der deutschen Sprache zeigt sich das besonders im Unterschied zwischen du und Sie.
Ausdruck von sozialer Distanz
Beispiel: „Könnten Sie mir helfen?“ vs. „Kannst du mir helfen?“ – Beide Sätze drücken dieselbe Intention aus, aber auf unterschiedliche Weise, je nach Beziehung zwischen Sprecher und Hörer. Auch Titel wie Frau Doktor oder Herr Professor enthalten soziale Deixis.
Textdeixis: Verweise im sprachlichen Kontext
Textdeixis bezeichnet Verweise innerhalb des sprachlichen Diskurses, etwa auf vorherige oder folgende Textteile. Beispiele: „wie bereits erwähnt“, „im nächsten Kapitel“, „dieses Argument“.
Abgrenzung zu Anaphern
Textdeiktische Ausdrücke ähneln Anaphern, gehen aber oft darüber hinaus, indem sie auf größere Einheiten oder auf die Kommunikation selbst verweisen („wie gesagt“). Damit Textdeixis funktioniert, muss das Bezugswort im Text eindeutig lokalisierbar sein.
Wie Vagheit durch Deiktika entstehen kann
Deiktische Ausdrücke bergen immer das Risiko der Vagheit, wenn sie ohne ausreichenden Kontext verwendet werden.
Typische Fälle unklarer Bezugnahme
Beispiel: „Gestern hat er es dort gefunden.“ – Wer ist er? Was ist es? Wo ist dort? Wann war gestern? Ohne zusätzliche Informationen ist der Satz nicht verständlich.
Ursachen und Folgen sprachlicher Unklarheit
Fehlende Kontextinformationen führen zu Missverständnissen – entweder muss der Hörer nachfragen, oder es kommt zu falschen Interpretationen. Besonders in wissenschaftlichen Texten ist diese Art von Vagheit zu vermeiden.
Strategien zur Vermeidung von Vagheit durch präzise Bezugnahme
Um deiktisch bedingte Vagheit zu verhindern, helfen folgende Strategien:
Kontext präzisieren
Statt „dort“ zu sagen, lieber „in den Alpen“. Anstelle von „damit“ besser „mit dem Vorschlag“.
Explizites Bezugswort verwenden
Wenn möglich, sollte der Referent benannt werden („Professorin Müller war nicht einverstanden“ statt „sie war nicht einverstanden“).
Beschreibende Wendungen statt Pronomen
„Nach dem Experiment“ statt „danach“, „in unserem Labor“ statt „hier“.
Konsistenz und Klarheit im Text
Vermeide Wechsel der Bezeichnungen und führe neue Begriffe kontrolliert ein.
Die Bedeutung eines klaren Bezugswortes
Ein Bezugswort ist der sprachliche Anker eines deiktischen Ausdrucks. Es gibt dem Hörer oder Leser die Information, auf wen oder was sich ein Ausdruck bezieht.
Beispielhafte Klarheit und typische Fehler
Fehlt das Bezugswort, wird der Text unverständlich. Häufige Kommentare in studentischen Arbeiten wie „Was ist das?“* zeigen, wie leicht sich unklarer Sprachgebrauch vermeiden ließe – durch eindeutige Referenz.
Wer sich der Funktionsweise von Deiktika bewusst ist und gezielt auf klare Bezugnahme achtet, schreibt verständlicher, logischer und professioneller. Besonders im wissenschaftlichen Schreiben sind präzise deiktische Ausdrücke und ein klar erkennbares Bezugswort Grundvoraussetzungen für Qualität.