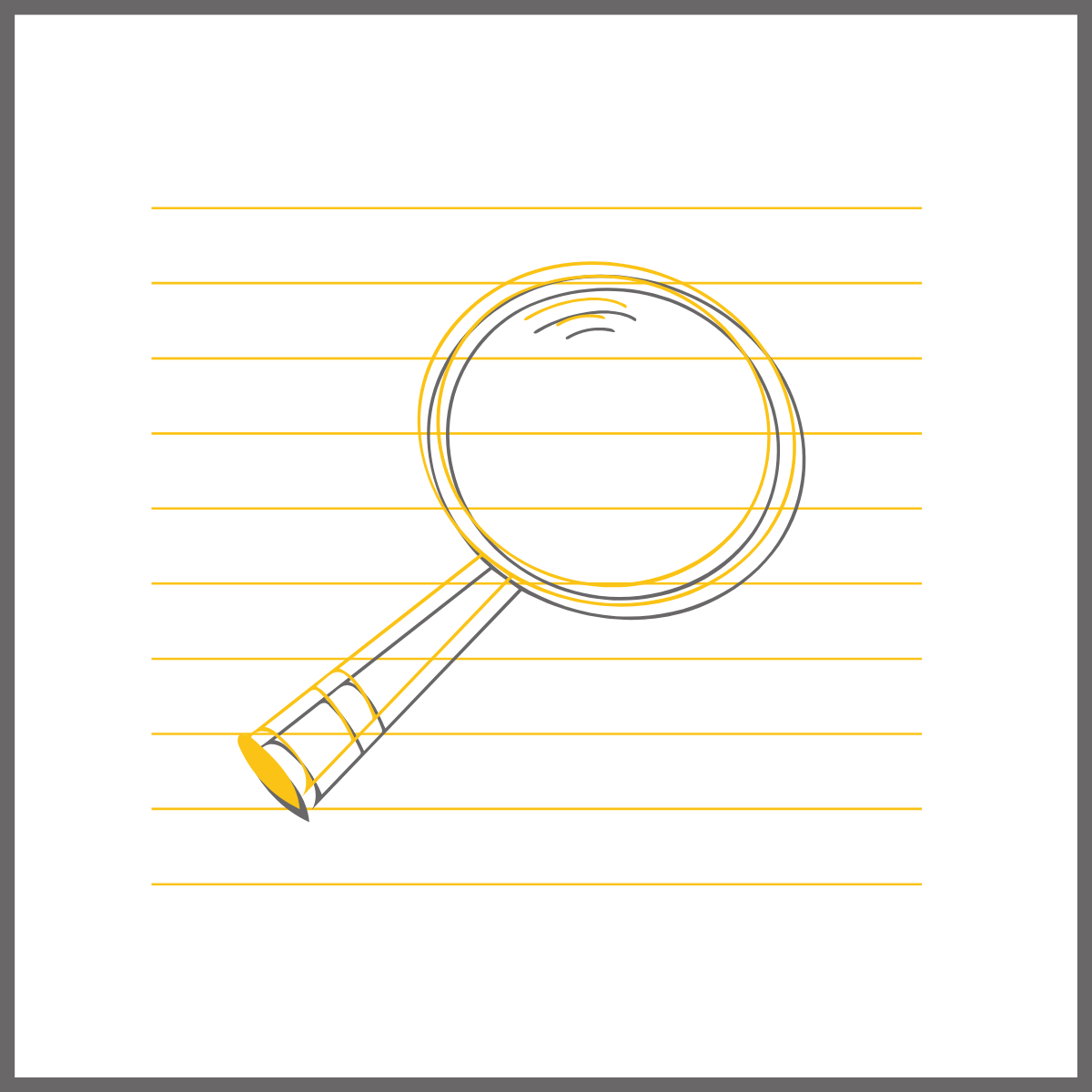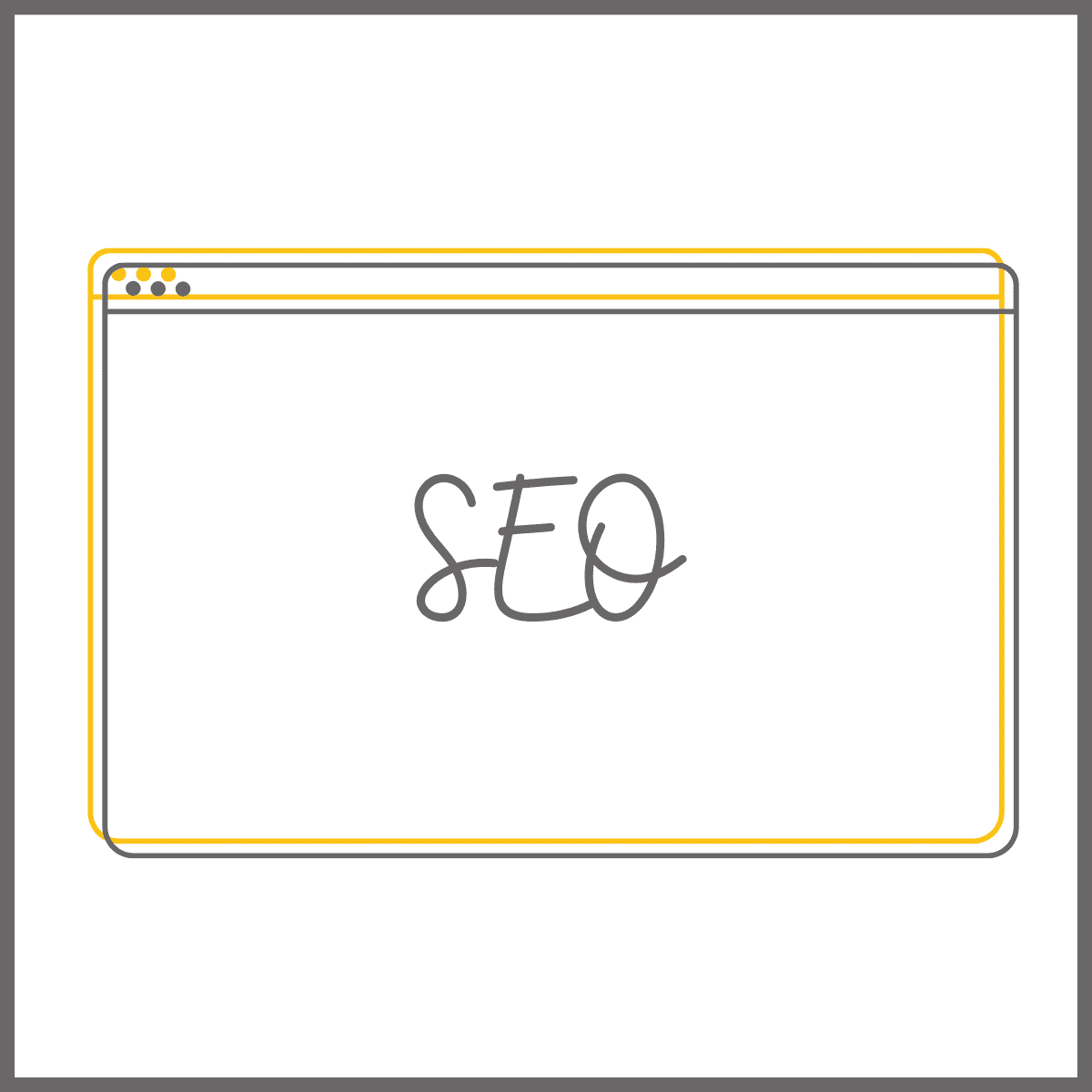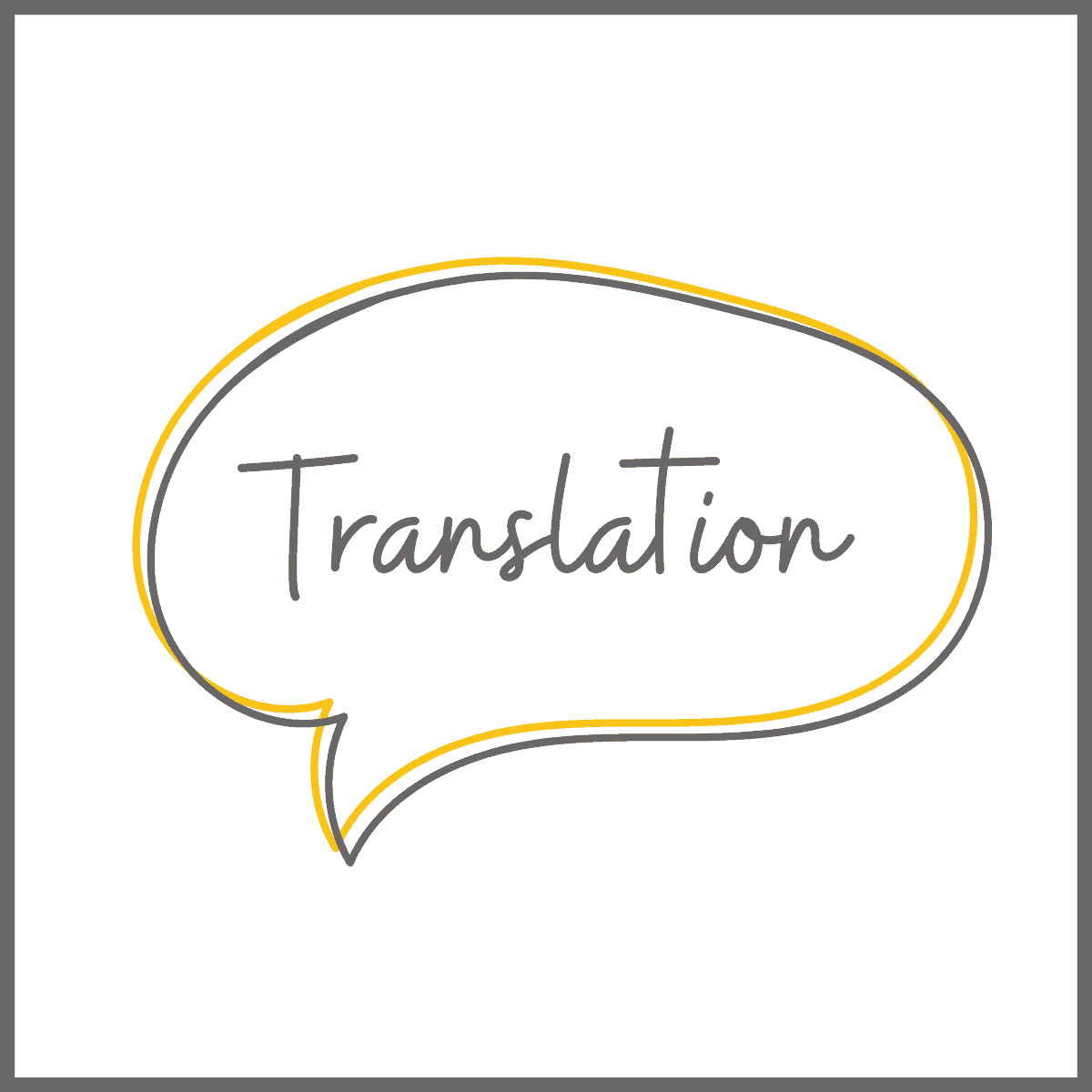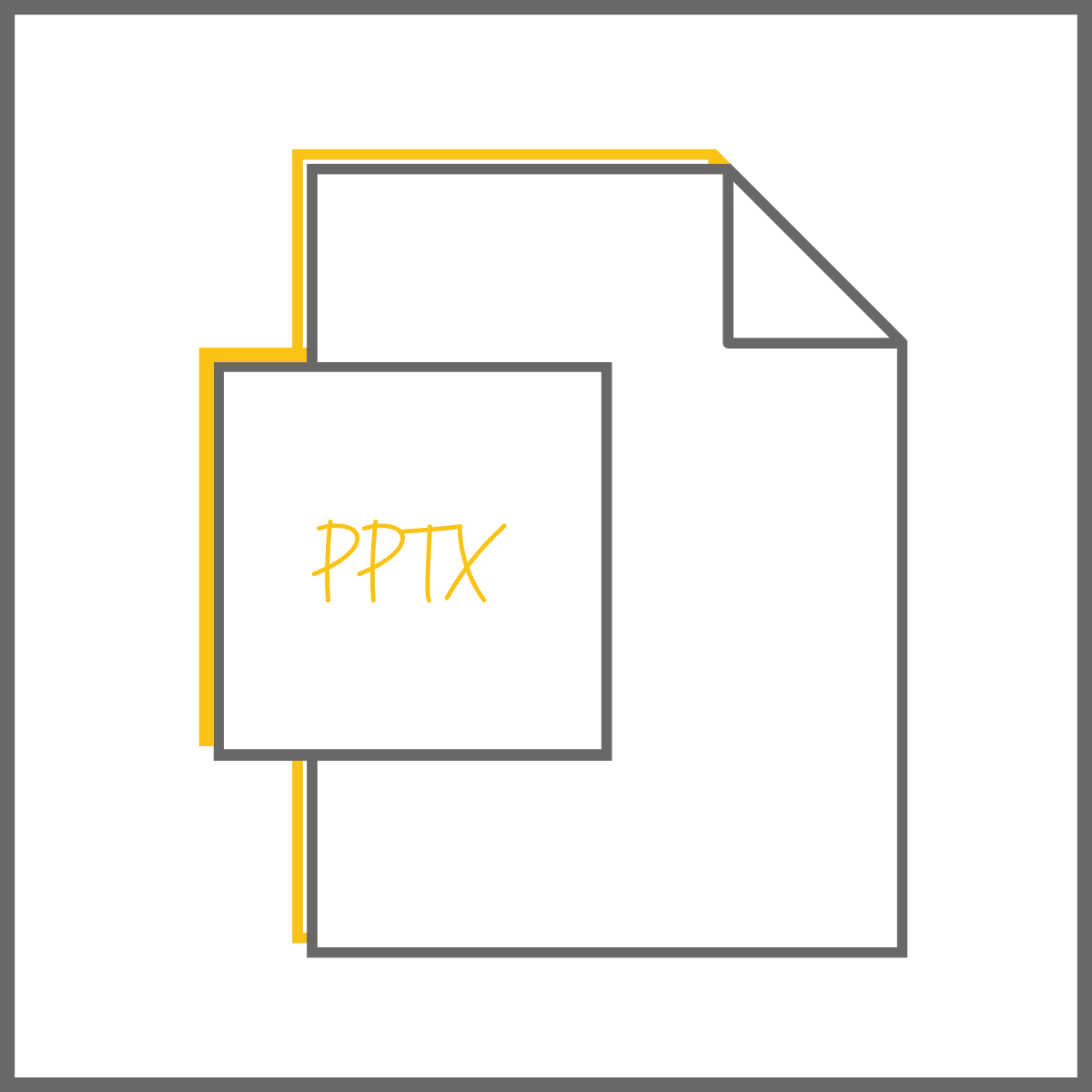Risiken sind allgegenwärtig und der Umgang mit ihnen eine fundamentale Herausforderung des menschlichen Lebens. Doch wie nehmen wir Risiken überhaupt wahr und welche psychologischen Mechanismen leiten unsere Entscheidungen beim Umgang mit Risiken?
Das psychometrische Paradigma
Die psychologische Risikoforschung hat sich intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und wichtige theoretische Ansätze und empirische Erkenntnisse geliefert. Ein zentrales Paradigma ist dabei das sogenannte psychometrische Paradigma, das in den 1970er Jahren von Paul Slovic und Kollegen als Reaktion auf die kontroversen gesellschaftlichen Diskussionen um neue Technologien wie die Kernenergie entwickelt wurde. Dieses geht davon aus, dass Risikowahrnehmung nicht objektiv ist, sondern von vielen subjektiven Faktoren abhängt.
Kernaussage des psychometrischen Paradigmas ist, dass insbesondere die Dimensionen “Schrecklichkeit” (Dread Risk) und “Unbekanntheit” (Unknown Risk) eines Risikos dessen subjektive Wahrnehmung bestimmen. Risiken, die als besonders schrecklich, katastrophal und unkontrollierbar eingeschätzt werden, lösen mehr Furcht aus. Ebenso Risiken, die als unbekannt und unvertraut gelten. Dies erklärt beispielsweise, warum Kernenergie von Laien als deutlich riskanter eingeschätzt wird als von Experten, da die abstrakten Gefahren schwer greifbar und schrecklich erscheinen. Demgegenüber wird die statistisch gesehen größere Gefahr des Autofahrens aufgrund der Vertrautheit und Kontrollierbarkeit als weniger riskant wahrgenommen.
Die Affektheuristik
Eng verknüpft mit dem psychometrischen Paradigma ist die sogenannte Affektheuristik. Sie besagt, dass Risikobewertungen und Entscheidungen unter Unsicherheit stark von intuitiven, emotionalen Reaktionen und gefühlsmäßigen Eindrücken geleitet sind. Je positiver der Affekt gegenüber einer Aktivität oder Technologie ist, desto niedriger wird das Risiko und desto höher der Nutzen eingeschätzt. Dies führt dazu, dass Risiken und Nutzen fälschlicherweise als negativ korreliert wahrgenommen werden. So erscheint beispielsweise Rauchen risikoreich aber wenig nützlich, während Flugreisen als nützlich aber wenig riskant eingestuft werden.
Individuelle Unterschiede
Auch individuelle Unterschiede in Persönlichkeit und Soziodemographie spielen eine große Rolle für die Risikowahrnehmung und -bereitschaft. Gemäß dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit korrelieren bestimmte Ausprägungen wie hohe Extraversion oder niedrige Verträglichkeit mit erhöhter Risikobereitschaft. Ebenso zeigt sich, dass Männer über verschiedene Lebensbereiche hinweg eher zu riskantem Verhalten neigen als Frauen. Zudem sinkt die Risikobereitschaft in der Regel mit zunehmendem Alter. Des Weiteren gibt es berufs- und branchenspezifische Unterschiede, die auf selbstselektive Mechanismen hindeuten.
Fazit
Die psychologische Risikoforschung zeigt somit auf, dass die Risikowahrnehmung höchst subjektiv ist und neben einer rationalen Informationsverarbeitung stark von emotional-intuitiven Prozessen geleitet wird. Dies zu berücksichtigen ist wichtig, um Risikoverhalten und -entscheidungen besser zu verstehen sowie die Risikokommunikation zwischen Experten, Behörden und Öffentlichkeit zu verbessern. Denn nur wenn man die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen kennt, können Risiken adäquat vermittelt und Maßnahmen akzeptiert werden. Insgesamt liefert die Psychologie des Risikos daher einen unverzichtbaren Beitrag für den kompetenten Umgang mit Risiken in einer komplexen, von Unsicherheit geprägten Welt.
Literatur:
Henrizi, P. (2023). Die Komplexität der Risikokommunikation. In: Basel, J., Henrizi, P. (eds) Psychologie von Risiko und Vertrauen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65575-7_6