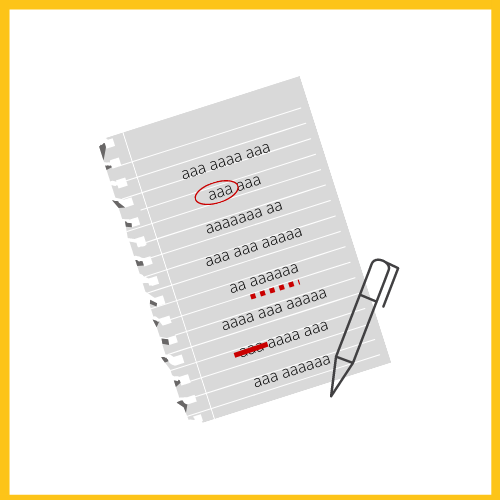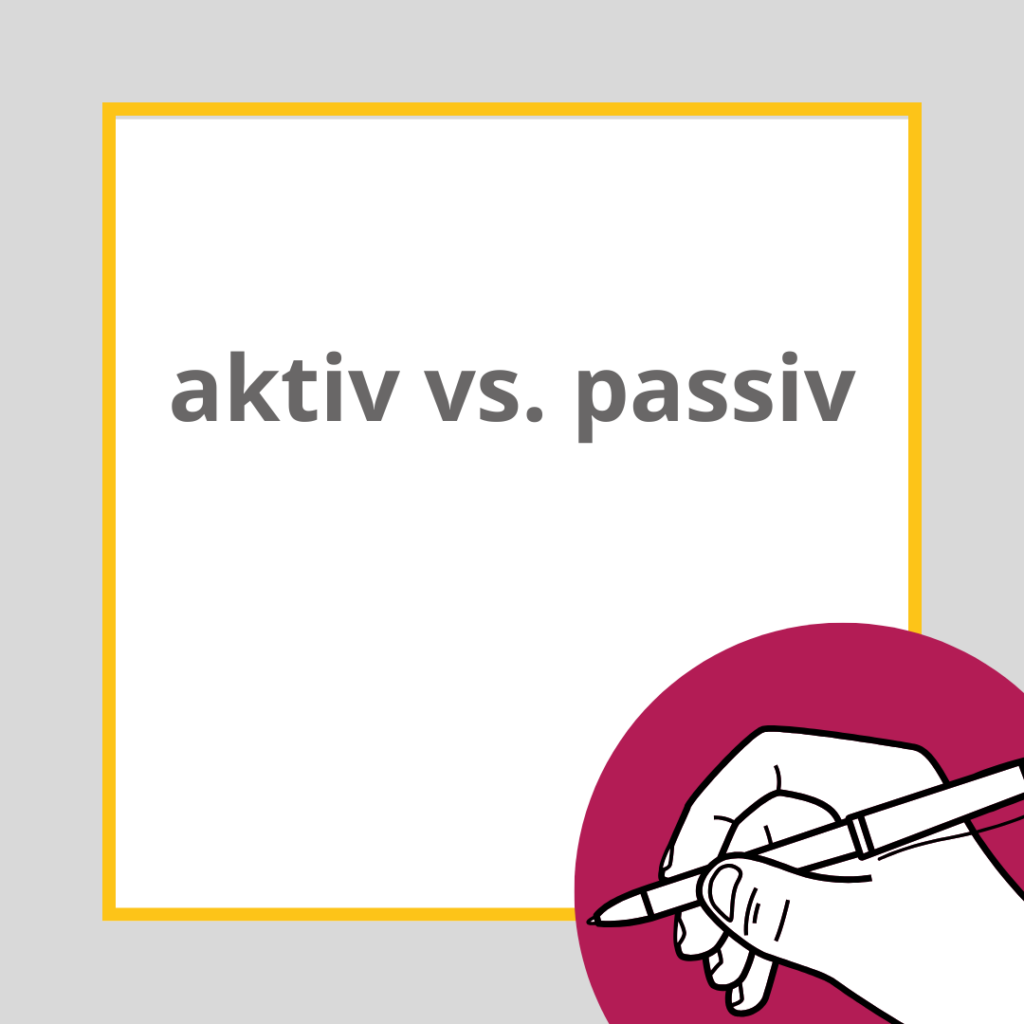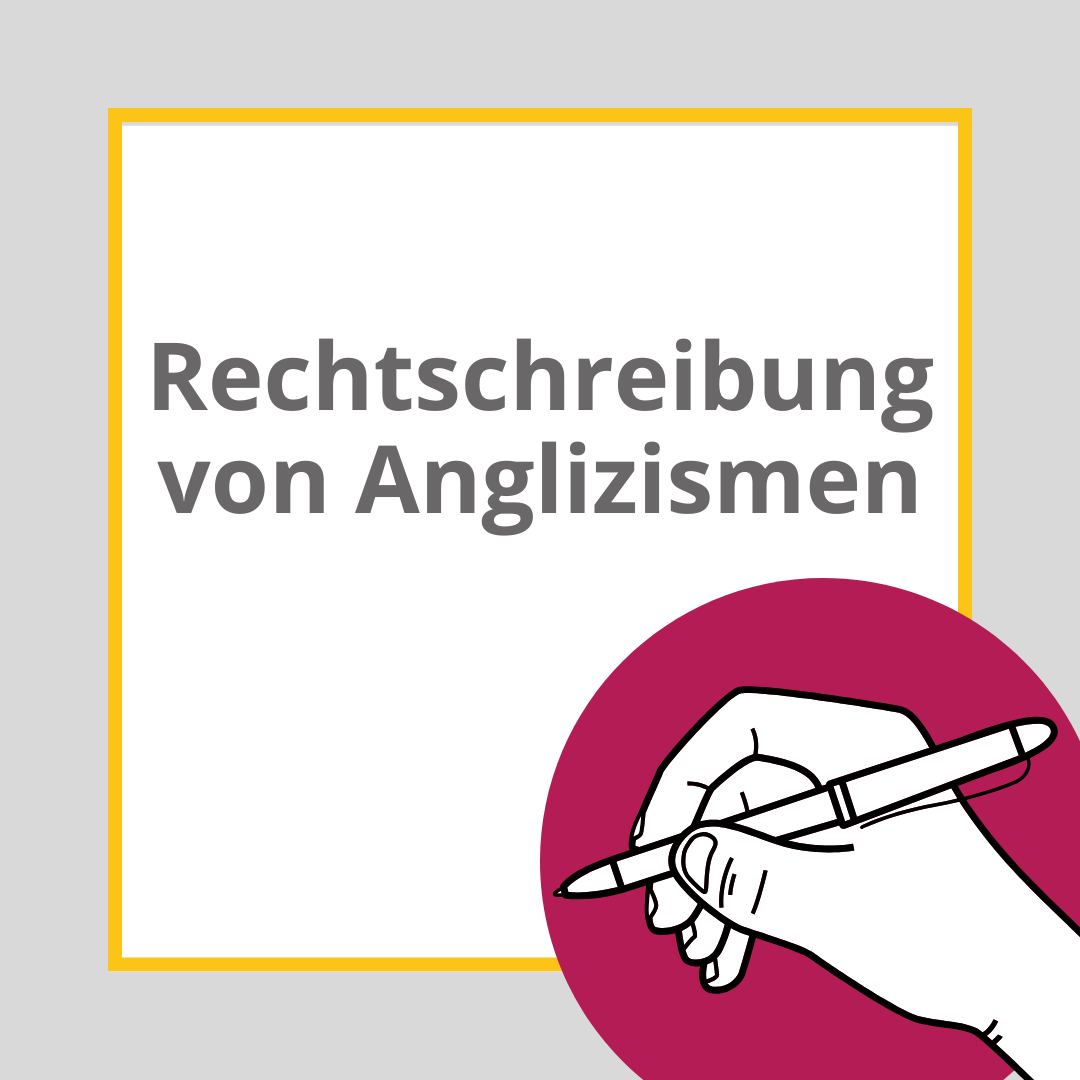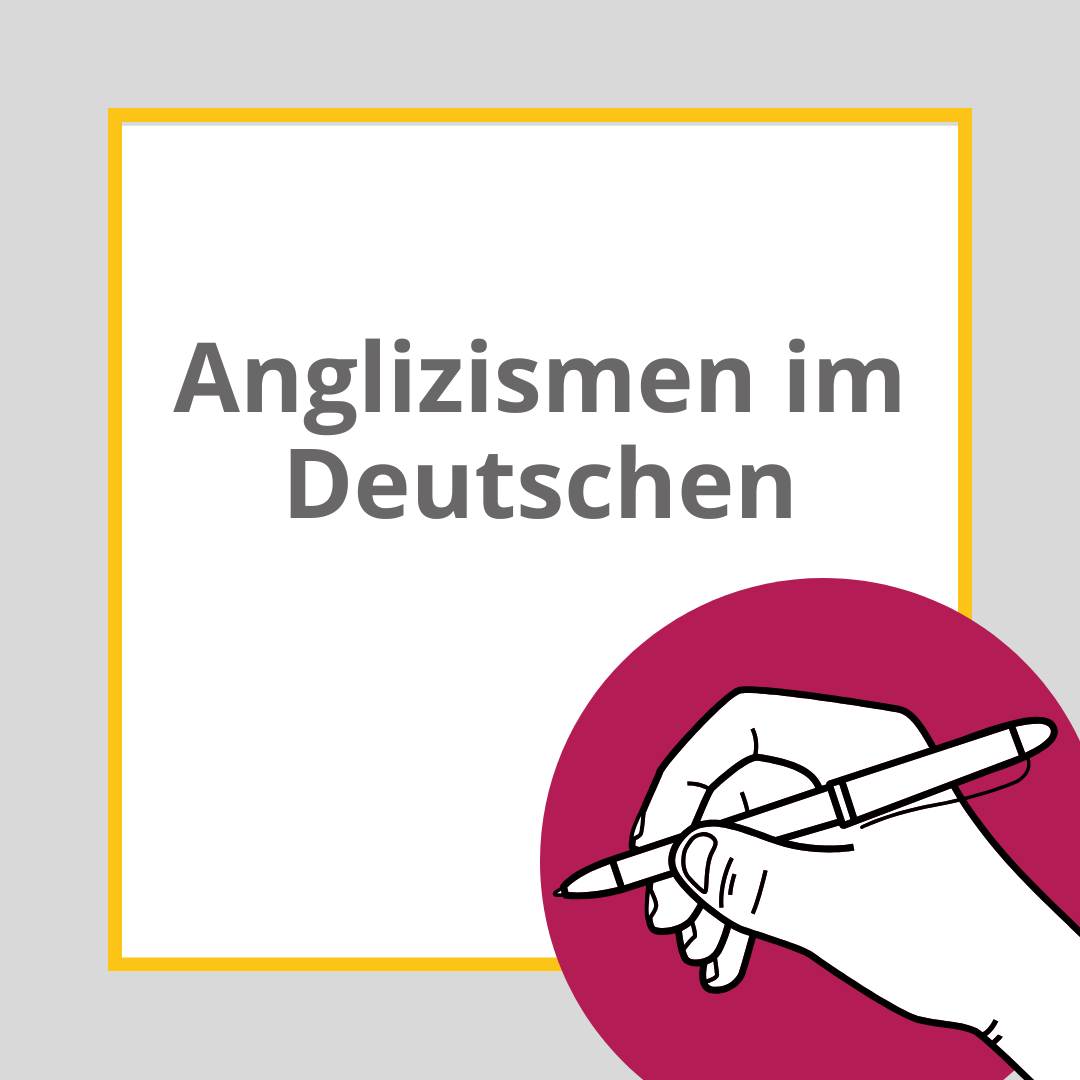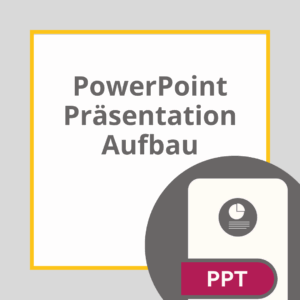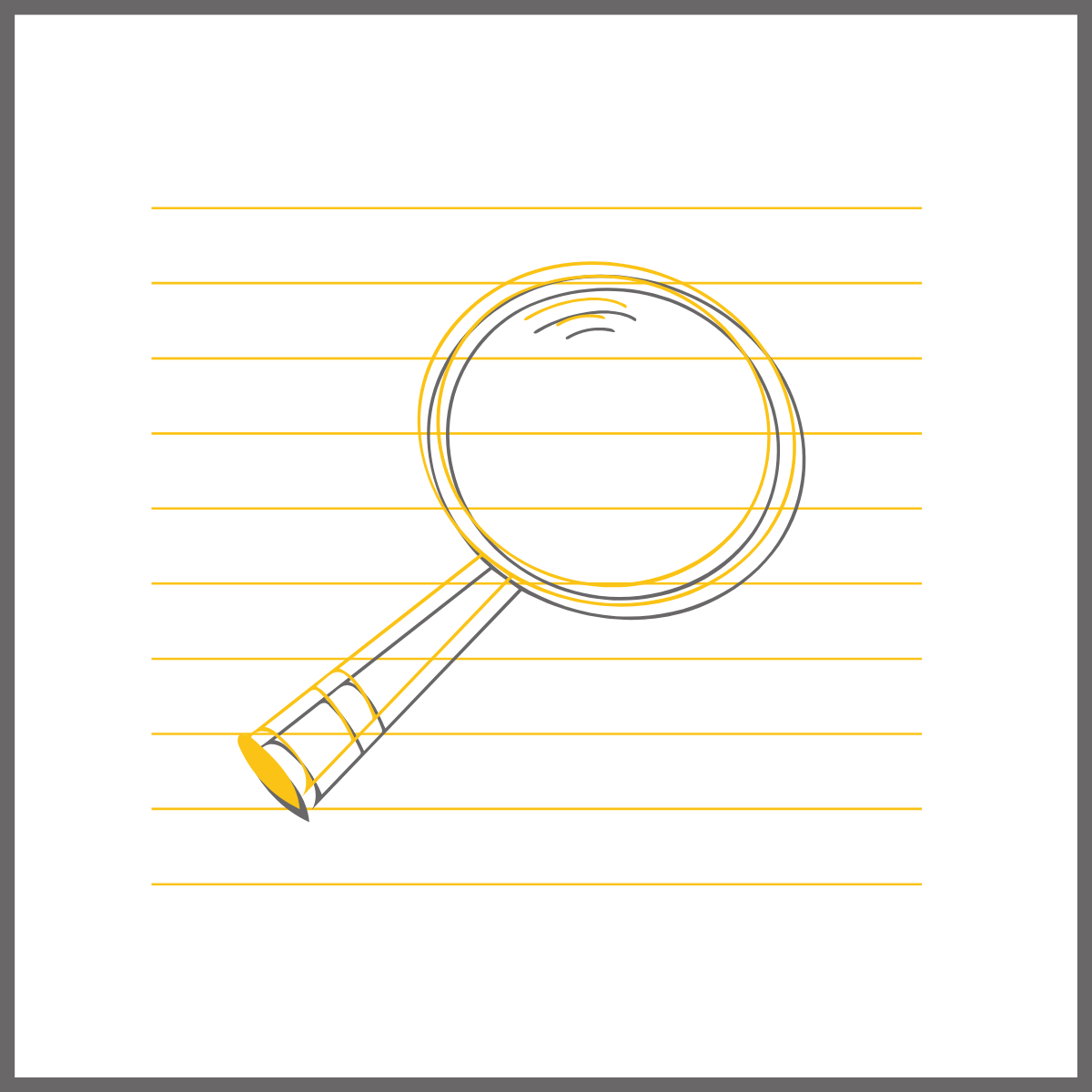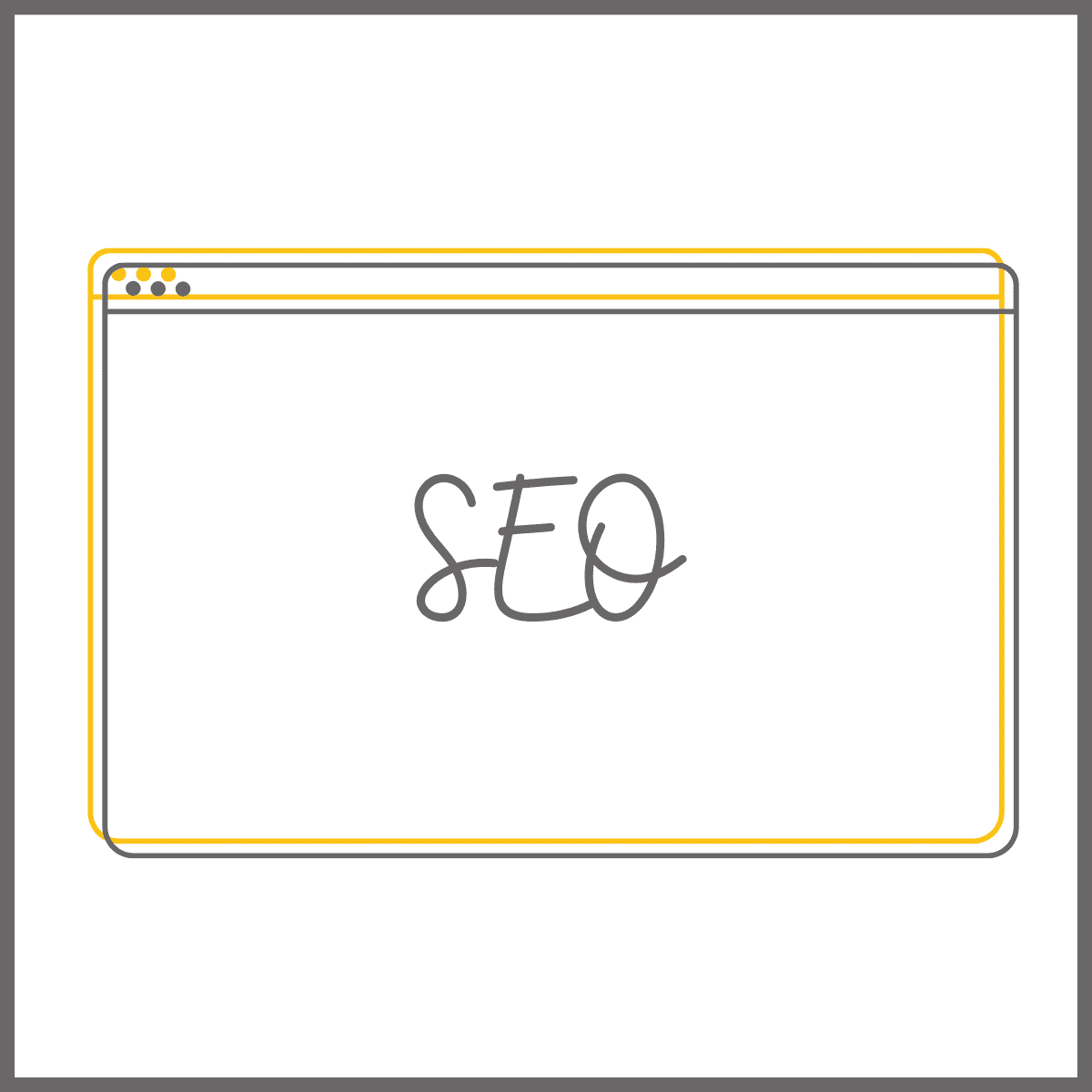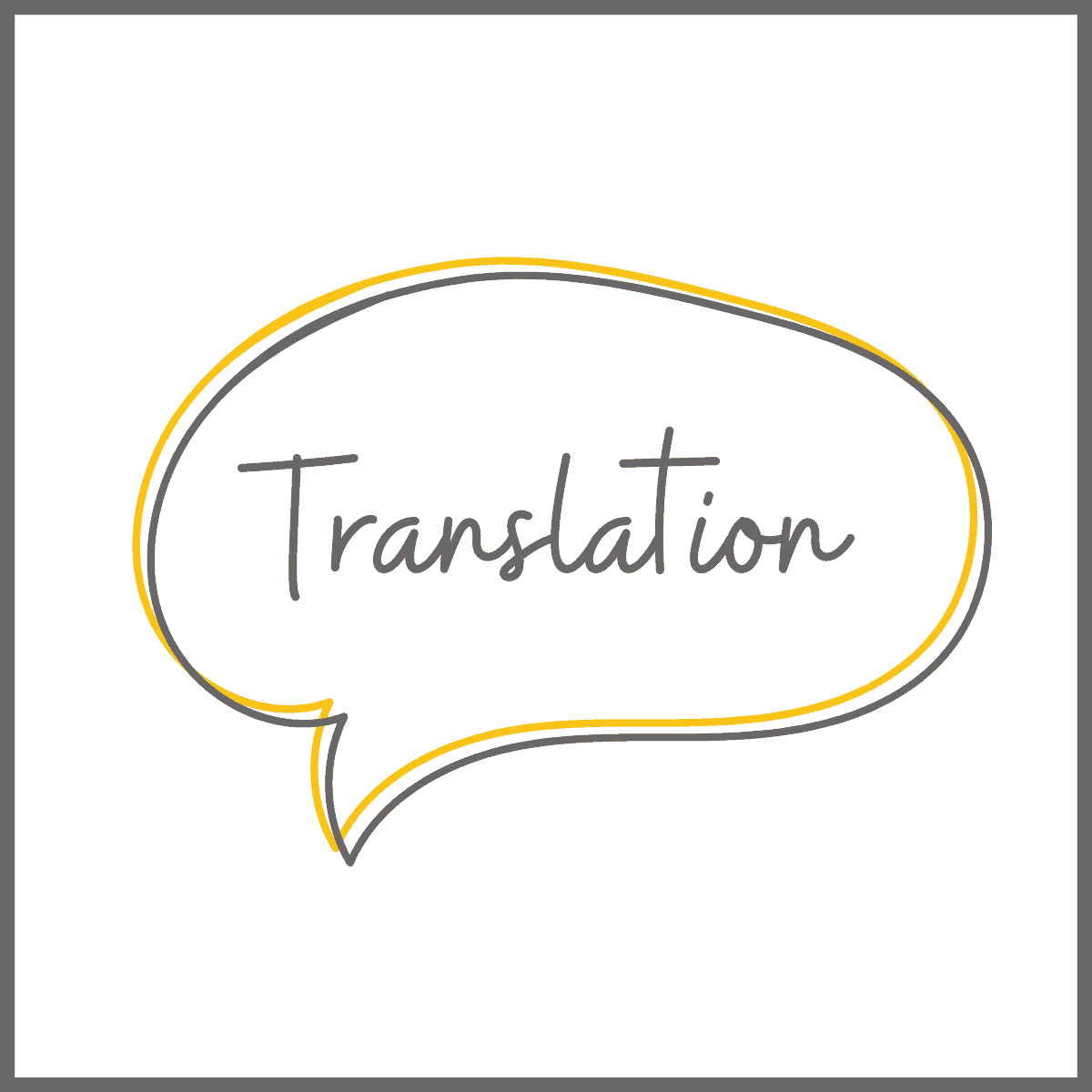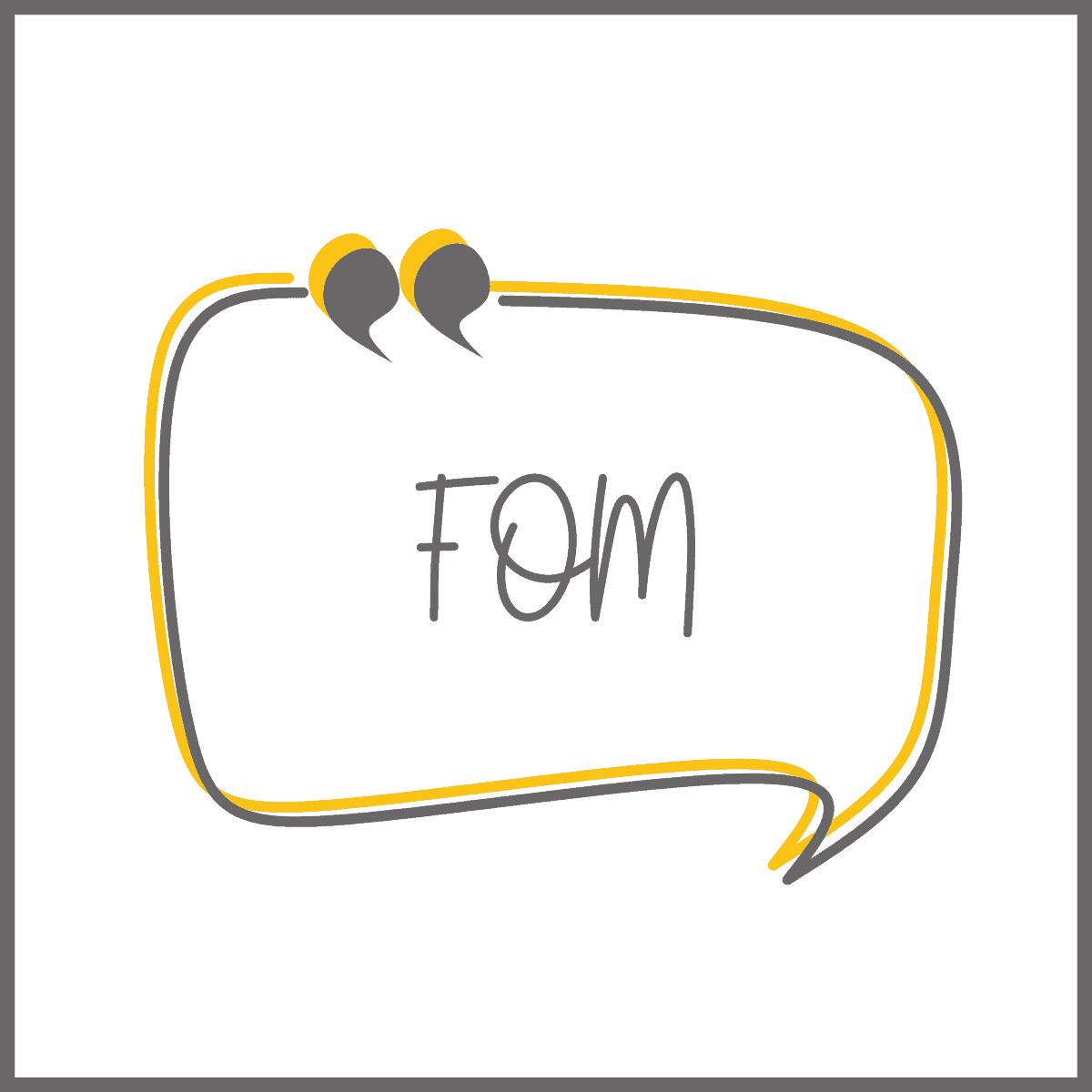In wissenschaftlichen Arbeiten stellt sich oft die Frage: Aktiv oder Passiv? Die Wahl der Satzstruktur beeinflusst die Klarheit, Präzision und Lesbarkeit eines Textes. Während aktive Sätze als direkter und verständlicher gelten, wird die passive Form häufig in objektiven Darstellungen genutzt. Doch welche Variante eignet sich besser für wissenschaftliches Schreiben?
Was ist ein Aktivsatz?
Ein Aktivsatz ist ein Satz, in dem das Subjekt die Handlung ausführt. Die handelnde Person oder Instanz steht im Mittelpunkt.
Beispiel:
Der Wissenschaftler analysiert die Daten.
Die Studierenden schreiben ihre Abschlussarbeit.
Was ist ein Passivsatz?
Ein Passivsatz stellt das Objekt oder die Handlung in den Vordergrund, während das Subjekt nicht genannt oder nur indirekt erwähnt wird.
Beispiel:
Die Daten werden analysiert.
Die Abschlussarbeit wird geschrieben.
Umwandlung aktiv in passiv
Um einen Aktivsatz in einen Passivsatz umzuwandeln, wird das Objekt des Aktivsatzes zum Subjekt des Passivsatzes. Das Verb wird in eine passive Form gesetzt (wird/wurde + Partizip II), und das ursprüngliche Subjekt kann mit „von“ ergänzt oder weggelassen werden.
Beispiele:
Aktiv: Der Wissenschaftler untersucht die Proben. → Passiv: Die Proben werden untersucht (von dem Wissenschaftler).
Aktiv: Die Forscher führten die Experimente durch. → Passiv: Die Experimente wurden durchgeführt (von den Forschern).
Umwandlung passiv in aktiv
Um einen Passivsatz in einen Aktivsatz umzuwandeln, wird das ursprüngliche Subjekt (falls genannt) wieder zum Handelnden gemacht, und das Verb erhält eine aktive Form.
Beispiele:
Passiv: Die Daten wurden analysiert. → Aktiv: Die Forscher analysierten die Daten.
Passiv: Die Hypothese wurde bestätigt. → Aktiv: Die Studie bestätigte die Hypothese.
Vorteile des Aktivsatzes in wissenschaftlichen Texten
Das Aktiv betont den Handelnden und erleichtert es dem Leser, den Gedankengang nachzuvollziehen. Zudem wirkt ein Text mit aktiven Formulierungen präziser und lebendiger. Besonders in der Einleitung, der Diskussion und den Schlussfolgerungen wissenschaftlicher Arbeiten empfiehlt sich das Aktiv.
Beispiel:
Aktiv: Die Forscher analysierten die Daten und zogen Rückschlüsse.
Passiv: Die Daten wurden analysiert und Rückschlüsse wurden gezogen.
Der aktive Satz zeigt sofort, wer die Handlung ausführt, während die passive Variante unpersönlicher wirkt.
Beispiele für vorteilhaftes Aktiv:
Ergebnisse erklären: „Die Studie zeigt, dass…“ anstatt „Es wird gezeigt, dass…“
Argumentationen verstärken: „Die Untersuchung bestätigt die Hypothese.“ anstatt „Die Hypothese wird bestätigt.“
Leserführung verbessern: „Diese Arbeit analysiert die wirtschaftlichen Auswirkungen.“ anstatt „Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden analysiert.“
Wann ist das Passiv sinnvoll?
Obwohl aktive Sätze oft bevorzugt werden, hat das Passiv im wissenschaftlichen Schreiben seinen Platz. Es eignet sich besonders, wenn der Fokus auf dem Prozess oder dem Ergebnis einer Untersuchung liegt, nicht auf den Ausführenden.
Beispiel:
Aktiv: Die Wissenschaftler bestimmten den pH-Wert der Lösung.
Passiv: Der pH-Wert der Lösung wurde bestimmt.
Hier ist die passive Form sinnvoll, da die Messung des pH-Werts wichtiger ist als die handelnde Person. Besonders in Methodik-Abschnitten wird das Passiv häufig verwendet, um Objektivität zu gewährleisten.
Beispiele für vorteilhaftes Passiv:
Prozesse beschreiben: „Die Proben wurden bei 20°C gelagert.“
Objektivität bewahren: „Es wurde eine neue Methode zur Messung entwickelt.“
Unwichtiges Subjekt ausblenden: „Es wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt.“
Stilistische Balance: Mischung aus Aktiv und Passiv
Die beste Strategie im wissenschaftlichen Schreiben besteht darin, eine ausgewogene Mischung aus Aktiv- und Passivkonstruktionen zu verwenden. Wichtige Ergebnisse sollten klar und prägnant mit aktiven Sätzen dargestellt werden, während methodische oder prozessbezogene Aussagen auch passiv formuliert werden können.
Ob aktiv oder passiv – die richtige Wahl hängt vom Kontext ab. Wissenschaftliches Schreiben profitiert von einer bewussten Kombination beider Satzstrukturen. Aktive Formulierungen sorgen für Klarheit und Dynamik, während das Passiv für Objektivität und Neutralität steht. Eine gezielte Anwendung beider Varianten verbessert die Verständlichkeit und Qualität wissenschaftlicher Texte erheblich.